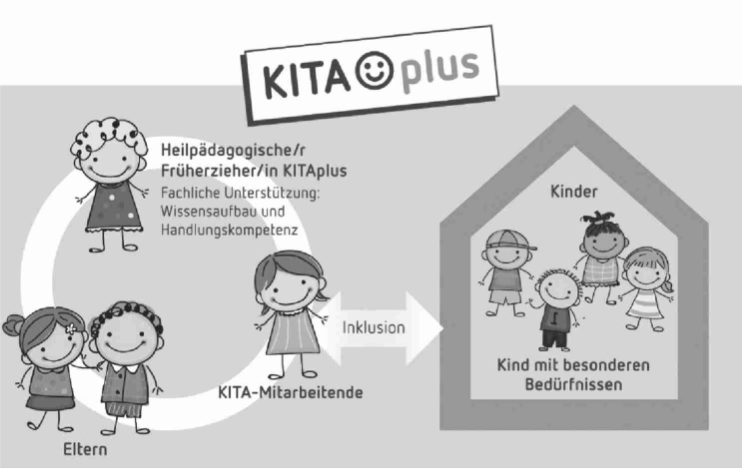(Schaffhauser AZ)

Symbolbild:Annatamila/AdobeStock
Nora Leutert
Wie ist sie? Können Sie sie beschreiben? Das fragt man Frau B. Es sei eine Seite von ihr,ihre Schattenseite, sagt Frau B. Sie habe viele Gesichter.
Manche vergleichen sie mit einer schwarzen Wolke, die den Kopf umnebelt. Churchill nannte die Depression seinen schwarzen Hund. Eine Traurigkeit, ein Schatten, der sich hervorkehrt und über alles legt, ein schwarzer Hund, der sich einem auf der Brust breit macht: Das Sprechen über Depression ist immer noch tabuisiert in der Schweiz, aber die Bilder verbreiten längst keinen Schrecken mehr. Gerade seit die Corona-Krise begann, ist das Thema näher denn je. Der schwarze Hund ist ein Haustier geworden.
Auch Frau B. spricht über ihre Depression so vertraut und abgeklärt, als ginge es um ihr Haustier. Um etwas, das wichtig ist, wenn auch nicht das Einzige im Leben.
Die AZ ist über die Schaffhauser Selbsthilfegruppe „Depression“ mit B. in Kontakt gekommen. Die Frau Anfang 60 war gerne bereit,einen Einblick in ihren Alltag zu geben.
Es ist ein sonniger Freitagmorgen. Frau B.sitzt am Küchentisch in ihrer kleinen, geräumigen Wohnung auf dem Land, unweit der Stadt Schaffhausen. Die Vorhänge sind zugezogen,die Waschmaschine brummt vor sich hin. B.erzählt, dass sie am Vorabend eine Freundin zu Besuch gehabt habe, sie erwähnt ihre erwachsenen Kinder, die Enkel, ihre Bekannten. Und eben: dann ist da noch die Depression.
Wie ein Gefängnis
Man kann gut nachvollziehen, was Frau B.über ihre Erkrankung erzählt. Denkt, man könne mitreden. Manches glaubt man sich aus eigener Erfahrung vorstellen zu können jetzt im Lockdown, anderes hat man von Bekannten gehört, die unter der Isolation leiden.
Frau B. sagt: «Den ersten Lockdown konnte ich für mich nutzen. Zuerst fühlte ich mich durch die Kurzarbeit isoliert, habe dann aber gemerkt, dass es geschenkte Zeit war. Ich habe viel meditiert, am Morgen bin ich früh raus zum Spazieren. Ich hatte trotz allem meine Struktur. Jetzt, im zweiten Lockdown, ist es anders. Ich fühle mich nicht mehr wohl zu Hause. Meine Burg ist nicht mehr meine Burg.Die Wohnung fühlt sich eng und ekelhaft an.Eher wie ein Gefängnis.»
Voilà der Lockdown, denkt man, so ist er.Die Einsamkeit schleicht sich ins einst traute Heim oder, wenn man nicht alleine ist, in dasGezänke, den Streit mit dem Partner. Antriebslosigkeit greift um sich, das Rumhängen, das nur noch müder macht und dennoch bewirkt,dass man in der Nacht nicht schlafen kann. Laut der jüngsten Umfrage der Universität Basel im Rahmen der Swiss Corona Stress Study stieg die Häufigkeit schwerer depressiver Symptome während der zweiten Welle im November verglichen mit der Zeit des ersten Lockdowns inder Schweiz stark an: Während im April noch 9 Prozent aller Befragten angaben, unter depressiven Symptomen zu leiden, waren es im November mit 18 Prozent doppelt so viele.
Viele Menschen haben solche Zwischentöne kennengelernt. Und doch ist es für jeden anders.
Weitermachen, funktionieren
Für Frau B. ist es mehr als eine schiefe Tonlage, das zeigt sich, je länger sie spricht. Plötzlich hält sie kurz inne am Küchentisch und horcht gegen das Fenster. Die Sonne schimmert unter den Vorhängen durch, lässt den Frühlingstag zaghaft erahnen, und Frau B. sagt, sie sei eine gute Schauspielerin. «Hören Sie, wie hübsch die Vögel zwitschern?», fragt sie – und fügt an:«Sehen Sie, ich kann mit Begeisterung über Dinge sprechen. Aber in mir drin ist es leer.Ich fühle keine Freude, nichts.»
Andere Menschen können sich vielleicht aus ihren Tiefs herausziehen. Sich auf den Frühling freuen. Auf das, was nach dem Lockdown kommt. Frau B. nicht. Für sie war der Lockdown gewissermassen schon immer da,und er hört nicht auf. «Meine Depression ist ein Teil von mir», sagt sie. Sie begleitet sie, seit sie vor acht Jahren in ihrem Job als Verkäuferin ein Burnout hatte. Und wahrscheinlich schon viel länger, vermutet B., schon immer.«Als Kind schrieb ich Tagebuch, und wenn ich das heute anschaue, muss ich sagen, schon da wollte ich nicht mehr leben.»
Eine Mutter, die sie nie in den Arm nahm.Eine Familie, in der sie sich wie ein fremd angenommenes Kind fühlte. Im Erwachsenenalter Jobs im Fachhandel, deren Belastung sie nur schwer standhielt: Oft hatte B. Rückenschmerzen und Gliedertaubheit, manchmal so stark, dass sie ihre Arme nicht mehr bewegen konnte.Immer war sie müde und angeschlagen, immer hatte sie Sorgen mit dem Geld. Und trotzdem sagte sie sich: Weitermachen, funktionieren,auch wenn es keinen Sinn macht.
B. war als Alleinerziehende für ihre Kinder verantwortlich. Vielleicht habe sie genau so lange durchgehalten, bis der Jüngste alt genug war, um selbst auf sich zu schauen, sagt Frau B. heute. «Ich weiss nicht, wie ich das alles geschafft habe.» 2013 kam sie mit Burnout in die Klinik. Ihre gesundheitliche Diagnose: Depression sowie später festgestellt eine komplexe traumatische Belastungsstörung.
«Ich kann mit Begeisterung über Dinge sprechen. Aber in mir drin ist es leer.»
Seit Jahren fällt es Frau B. schwer, sich wieder ins Arbeitsleben einzugliedern. Alles ist zu viel, an gewissen Tagen schon das Aufstehen,das Duschen. Wenn es ihr einmal hundsmiserabel geht, liegen Suizidgedanken nahe. Die Sehnsucht, dass es ruhig ist, dass einen nichts mehr belastet. Es seien aber lediglich Gedanken, sagt B., und wenn sie diese habe, verheimliche sie sie nicht vor ihrer Psychiaterin.
Im vergangenen Dezember hat Frau B. ihren Job in einem Fachmarkt nach kurzer Zeit wieder aufgeben müssen. Jeden Tag kämpft sie damit, sich aufzuraffen, um Bewerbungen zu schreiben. Sonst hat sie kaum Aufgaben, die Energie verpufft in der kleinsten Bewegung.Der Lockdown macht es noch schlimmeer.
Wütend über die Massnahmen
Der Lockdown fördere depressive Symptome,sagt Bernd Krämer, Leiter der psychiatrischen Dienste der Spitäler Schaffhausen. Die meisten Menschen würden dem in der Regel mit genügend Ressourcen gegenüberstehen, eine hospitalisationsbedürftige mittelschwere bis schwere depressive Störung entwickle sich kaum einfach so aus dem Lockdown. Für verletzliche Menschen aber könnten die aktuellen Restriktionen der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringe und der eine Depression reaktiviere, sagt Bernd Krämer.Auch seien im Moment die psychiatrischen Therapiemöglichkeiten durch die Corona-Schutzmassnahmen eingeschränkt: Es ist zurzeit schwierig,bei Patienten Aktivitäten zu fördern, die sie normalerweise gerne tun und die ihnen Freude machen. Auch Belastungserprobungen, beidenen die Patienten versuchsweise in ihren normalen Alltag zurückkehren, sind durch den Lockdown gerade kaum durchführbar.
Für Frau B. fällt im Moment die Selbsthilfe-Gruppe weg: Einige Mitglieder sind in der Klinik, andere sind momentan ausgestiegen.Aber auch scheinbar kleine Einschränkungen rauben B. die Tagesstruktur, die für sie wichtig ist. Dass sie sich nirgends hinsetzen kann,wenn sie nach einer Therapiestunde in der Stadt noch eine Freundin treffen will. Dass sie von täglichen Gewohnheiten wie dem Besuch im Lädeli einer Bekannten absehen muss. Das alles kann B. nicht einfach wegstecken. Was andere als vorübergehend akzeptieren oder von sich persönlich abstrahieren, zehrt an ihren Kräften. «Mein Stresslevel ist enorm hoch»,sagt sie. «Ich lese auch fast keine News zum Thema Corona mehr.» Es macht sie wütend,dass über die Bevölkerung bestimmt wird,vor allem wenn die Regierung bei den Massnahmen dann noch einen Zickzackkurs fährt.Eine Maske im Gesicht zu haben, ist für sie unerträglich körperlich, aber auch nur schon vom Gedanken her. «Das sind fremde Bilder für uns», sagt sie und schüttelt den Kopf.
Für sie zieht die Krise nicht vorüber. Es fehlt ihr die Aussicht auf das, was danach kommt. Bleibt die Hoffnung, dass sich die Schattenseite, der schwarze Hund, wieder in eine Ecke der Wohnung verzieht, wenn draussen Normalität einkehrt.
Selbsthilfegruppe Depression
Beieiner Depression können Fachleute weiterhelfen. Aber auch der Austausch unter Betroffenen tut gut. In der Selbsthilfegruppe Schaffhausen sind neue Mitglieder sehr willkommen. Die Gruppe trifft sich, wenn drei bis vier Leute mitmachen, alle zwei Wochen am Dienstagabend um 18 Uhr im Sitzungsraum der Beratungsstellen Pro Infirmis, Krebsliga und Lungenliga an der Mühlentalstrasse 84 in Schaffhausen. Für mehr Informationen melden Sie sich beim SelbsthilfeZentrum Region Winterthur, welche die Schaffhauser Gruppe organisiert, unter: 052 21380 60 oder unter info@selbsthilfe-schaffhausen.ch