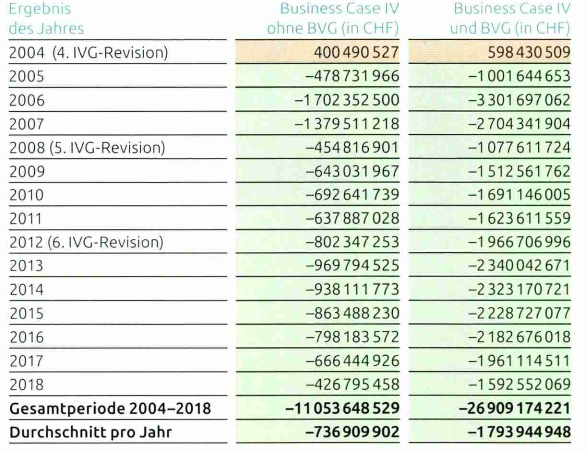(Procap / Das Magazin)

Geschaut ist schnell, und mal ist ein Blick neugierig oder mitleidig, mal staunend oder vernichtend. Umso wichtiger sind identitätsstiftende und wertfreie Bilder von Menschen mit Behinderungen, denn deren bildliche Darstellung prägt die Art und Weise, wie die Gesellschaft über Betroffene denkt, und welchen Platz sie ihnen einräumt.
Text Sonja Wenger Fotos Pro Infirmis/zVg
«Ungehindert behindert», die aktuelle Pro-Infirmis-Kampagne unter dem Motto «Jetzt übernehmen wir die Werbung», bringt es auf den Punkt. Fast jede vierte Person in der Schweiz lebt mit einer Behinderung. Trotzdem scheint es, dass Menschen mit Behinderungen in der medialen Öffentlichkeit kaum sichtbar sind und wenn doch, dann meistens im Zusammenhang mit ihrer Behinderung, respektive als Opfer von Behördenwillkür oder Diskriminierung. Heute gibt es in der Schweiz viele Menschen mit Behinderungen, die selbstbewusst und selbstbestimmt ihr Leben leben. Sie sind beispielsweise in den sozialen Medien aktiv oder setzen sich unermüdlich für mehr Inklusion, für politische oder kulturelle Partizipation und Sensibilisierung ein. Dennoch sind sie nur selten Teil des sogenannten Mainstreams, also einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.

Pro-Infirmis-Kampagne
Pro Infirmis hat mit ihrer Kampagne deshalb dort angesetzt, wo alle hinsehen, bei der Werbung, denn «Werbung ist ein Spiegel der Gesellschaft». Die nationale Fachorganisation der privaten Behindertenhilfe in der Schweiz schreibt auf ihrer Website, dass Werbung mehr sei als einfach nur Reklame, die dem Verkauf von Produkten dient. Werbung sei auch Projektionsfläche für Wünsche und Sehnsüchte, das Abbild einer Gesellschaft und davon, was als schön und begehrenswert gilt. Und: Werbung schaffe Vorbilder und Identifikationsfiguren, etwas, das vielen Menschen mit Behinderungen in der Schweiz bisher fehlt.
Die Art und Weise der Darstellung
Genau hier ist der Knackpunkt. Es geht nicht in erster Linie um die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen, sondern um die Art und Weise, wie sie in der Öffentlichkeit und in der Gesellschaft abgebildet und wahrgenommen werden. Wenn wir in der Geschichte zurückschauen, sehen wir, dass Menschen mit Behinderungen schon immer sichtbar waren. Doch was die Gesellschaft von der Antike über die Neuzeit und teilweise bis heute über Behinderungen dachte und wie sie mit den betroffenen Menschen umgegangen ist, jagt einem immer wieder Schauer über den Rücken. So betrachtete man teilweise bis ins späte 18. Jahrhundert eine Behinderung oder Krankheit entweder als Bestrafung für unmoralisches oder gottloses Verhalten oder als Vorboten schlimmer Ereignisse wie Kriege oder Naturkatastrophen.
Gemälde, Zeichnungen und Flugblätter aus dem Mittelalter zeigen, dass die betroffenen Personen aufgrund ihrer Behinderung als Narren, also als «dumm und gottesfern» galten und entweder ausgegrenzt und ausgelacht, auf Jahrmärkten zur Schau gestellt oder bemitleidet wurden. Einige wenige konnten als Narren und Närrinnen, als Zwerge oder als bizarre «Wundergeburten» wie der «Haarmensch» an den fürstlichen Höfen ein Auskommen finden und wurden teilweise gar berühmt. Doch in den meisten Fällen wurden sie zusammen mit Aussätzigen oder chronisch Kranken in Hospitälern, Armenasylen oder «Irrenhäusern» weggesperrt und durften nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben.

Die Aktion mit Schaufensterpuppen, die den behinderten Körpern verschiedener Personen nachgebildet waren, sorgte 2013 für viel Aufsehen. Das sehr sehenswerte Video dazu findet man auf youtube unter dem Stichwort: Pro Infirmis «Wer ist schon perfekt?».

Der für seine Trinkfestigkeit berühmte «Zwerg Perkeo» lebte am Hof des Kurfürsten Karl III. Philipp von der Pfalz und war Hüter des Grossen Fasses im Heidelberger Schloss.

Bildnis des Petrus Consalvus, dem sogenannten Haarmenschen (etwa 1580), der unter anderem am Hof von König Heinrich II. in Frankreich lebte.

Es gibt wenige Quellen zum Thema «Hilfsmittel imMittelalter». Die Möglichkeiten hingen von der Stellung der einzelnen Person in der Gesellschaft ab. Der Mann auf dem Bild benutzt Holzstützen für Füsse und Hände als Gehhilfen.

Spendenkampagnen von 1940 bis 1984 (von links nach rechts). Symbole statt Menschen mit Behinderungen.

Jusepe de Ribera, «Grosser grotesker Kopf», 1622.

Gross, bunt und schön fotografiert: Der behinderte Körper wird erstmals in der Öffentlichkeit sichtbar.

Im «Königreich der kleinen Leute» leben in einem Freizeitpark nahe der chinesischen Stadt Kunming über hundert kleinwüchsige Menschen, die das Publikum täglich mit einer Show unterhalten.

Der US-amerikanische Zirkuspionier Phineas Taylor Barnum engagierte für seinen Zirkus oft Darstellerinnen und Darsteller mit besonderen körperlichen Merkmalen, darunter auch «Tom Thumb, den kleinsten Mann der Welt».

Frank Lentini war ein italoamerikanischer Sideshowdarsteller, der als siamesischer Zwilling mit einem nur teilweise entwickelten «parasitischen Bruder» geboren wurde und über drei verschieden lange Beine verfügte. Er trat unter anderem in den Shows von P. T. Barnum auf.
Wissenschaftliche» Kategorien und Freakshows
In der Neuzeit, also ab dem 17. Jahrhundert, als sich die Natur- und Humanwissenschaften weiterentwickelten, begann man erstmals, über kranke und behinderte Menschen zu forschen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler interessierten sich zunehmend für den Menschen als Individuum, dafür, wie sein Körper funktioniert und wie man die menschliche Arbeitskraft am besten nutzen kann. Jene Menschen, die in irgendeiner Weise auffielen, die nicht der Norm der Zeit entsprachen oder von ihr abwichen, wurden untersucht und in verschiedene «Arten und Besonderheiten» unterteilt. Lange glaubte man, dass das körperliche Aussehen mit dem persönlichen Charakter zu tun hat. Bilder aus jener Zeit zeigen Menschen mit Behinderungen deshalb häufig als Karikatur, bei der die Behinderung mit Narrheit, Dummheit oder Geistesschwäche gleichgesetzt wird. Dies wird deutlich am Porträt von Jusepe de Ribera (1622). Es zeigt einen Menschen mit einem vergrösserten Hals (Kropf), dessen Schilddrüse erkrankt ist. Der Mann ist jedoch übertrieben und komisch gezeichnet und trägt eine Zipfelmütze und Kragen, die damals typische Kleidung der Narren.–Die Forschung jener Zeit trug also nur wenig dazu bei, Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft zu integrieren. Vielmehr entstanden ab dem 19. Jahrhundert immer mehr Zirkusse und die sogenannten Freakshows, in denen behinderte oder kranke Menschen wie auf den Jahrmärkten des Mittelalters zur Schau gestellt wurden. So hatte der US-amerikanische Zirkuspionier P. T. Barnum mit seinen «Menschenshows» viel Erfolg, in denen er beispielsweise «Tom Thumb, den kleinsten Mann der Welt», siamesische Zwillinge oder einen dreibeinigen Jungen präsentierte. Parallel dazu eröffnete man um 1900 überall auf der Welt sogenannte Liliputaner-Städte, in denen klein wüchsige Menschen lebten, die in ihrem Alltag von Besucherinnen und Besuchern beobachtet werden konnten. In Deutschland wurde die letzte «Stadt» dieser Art 1996 geschlossen. In China sind sie bis heute populär und werden jedes Jahr von Hunderttausenden besucht.
Bereits dieser kurze Blick in die Geschichte zeigt, dass man Menschen mit Behinderungen seit der Antike künstlerisch abbildete, auch weil sie als eine Art exotischer Gegenpol zu den Normvorstellungen von Schönheit und Körperideal betrachtet wurden. Dass Menschen mit Behinderungen in der Kunst selbst eine aktive und gestalterische Rolle einnehmen, ist eine erst jüngere, zeitgenössische Entwicklung, die jedoch künftig viel dazu beitragen wird, die Sehgewohnheiten der Gesellschaft zu verändern.
Keine Norm, sondern Normalität
Bei jeder künstlerischen Darstellung und Auseinandersetzung geht es immer um Blicke. So ist der behinderte Körper seit frühester Zeit öffentlichen Blicken ausgesetzt, er wird bewertet und ist in diesem Zusammenhang oft auch Grenzüberschreitungen ausgeliefert, vor allem aber wird er angestarrt. Hierbei gibt es die verschiedensten «Typen» von Blicken, die je nach Situation positiv oder negativ zu werten sind. Es gibt den neugierigen und staunenden Blick, den mitleidigen, denmedizinischen oder gar den vernichtenden Blick, aber auch den emanzipierten oder bewundernden Blick.Stets werden auf Menschen mit Behinderung jedoch gesellschaftliche oder persönliche Bilder projiziert, die oft auch von der Angst gegenüber und vor Behinderungen geprägt sind Bilder sind zudem Zeugen unserer Zeit und unseres Denkens und formen Meinungen. Sie verändern sich in der Art und Weise, wie sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt. Während in der Schweiz von den vierziger bis in die achtziger Jahre noch mit Symbolen wie angeketteten Flügeln oder einer lachenden Sonne um Spenden für Menschen mit Behinderungen geworben wurde, hat sich die Bildsprache ab Ende der neunziger Jahre vollständig verändert. Plötzlich waren Menschen mit ihrer Behinderung prominent auf riesigen, bunten, schön fotografierten Plakaten zu sehen. Der behinderte Körper war nicht länger ein Tabu, sondern eine Tatsache.
Inzwischen wird die erste Generation jener Menschen mit Behinderungen erwachsen, für welche Gleichstellungsrechte eine Selbstverständlichkeit sind und welche diese Rechte auch einfordern. Dies beinhal-tet auch die Deutungshoheit über die Art und Weise, wie sie selbst in Bildern oder Geschichten dargestellt werden. Ziel bei allen Bemühungen ist die Haltung, dass eine Behinderung nicht länger als Abweichung der Norm gesehen wird, sondern Teil der Normalität ist.
Quellen:
– «Das Bildnis eines behinderten Mannes – Bildkultur der Behinderung vom 16. bis ins 21. Jahrhundert», Petra Flieger, Volker Schönwiese, AG SPAK Bücher, Neu-Ulm 2007.
– Pro Infirmis, Kampagne «Ungehindert behindert», 2019. – Vortrag «Bilder von Behinderung» von Wiebke Schär, Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben Deutschland, Berlin 2014.
– Vortrag «Vom Krüppel zum Model. Darstellung von Behinderung in der Öffentlichkeit. Eine Bilderreise». Alex Oberholzer, Zürich 2019.