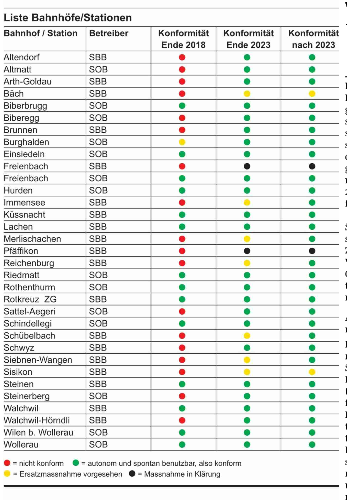(Bieler Tagblatt)
Olten Vor 100 Jahren ist «Pro Infirmis» gegründet worden. Der umtriebigen Organisation ist es wohl zu verdanken, dass 1960 schliesslich die Invalidenversicherung ins Leben gerufen wurde.

Demonstrationfür Behindertenrechte im Jahr 1981 in Bern. KEY
Im Jahr 1920 wurde in Olten eine Organisation mit dem haarsträubenden Namen «Schweizerische Vereinigung für Anormale»(SVfA) gegründet. Es gibt sie noch heute. Seit 1935 heisst sie Pro Infirmis. Dem Begriff «anormal» ist die Ausgrenzung eingeschrieben, denn nur das «Normale» war Jahrhunderte lang gottgewollt. In der Antike durften Väter mit Mängel behaftete Kinder aussetzen oder töten lassen. Und noch der deutsche Reformator Martin Luther empfahl,«Wechselbälger» zu ersäufen -behinderte Babys.
Bewunderte Behinderte
Bewunderte «Krüppel» gab es zwar immer schon: Hephaistos,der griechische Gott des Feuers,war gehbehindert, auf einem Auge blind und entstellt. Trotzdem wurde er als Schmied von den Göttern geschätzt. Auch die einäugigen Zyklopen waren nützlich, beispielsweise weil sie Blitze schmiedeten für Zeus. Ebenfalls halb blind und doch mächtig war der nordische Gott Odin.
Von Menschen, die früher vom herzlosen Volk «Krüppel»,«Idioten»,«Kretins» oder«Blödsinnige» genannt wurden,unterschieden sich diese «Superbehinderten» vor allem dadurch,dass sie integriert waren – etwas,was sich auch die Pro Infirmis auf die Fahne geschrieben hat.
Die SVfA war ursprünglich der Dachverband von verschiedenenin der Behindertenfürsorge tätigen Gruppen und sollte Vorstösse auf Bundesebene sowie das Sammelwesen koordinieren.
Während der Industrialisierung hatten sich die kleinen Behindertenorganisationen vermehrt: Kinderarbeit undschlechte Arbeitsbedingungen brachten neue Beeinträchtigungen hervor, während gleichzeitig Grossfamilien auseinanderfielen.
In Fabriken, Gewerbevereinen und einzelnen Quartieren wurden solidarische Kranken-, Invaliden- und Sterbe-Kassen eingerichtet, welche behinderte Mitglieder finanziell unterstützten.Der Ruf nach einer übergeordneten Invalidenversicherung (IV)wurde laut. 1919 wurde das Traktandum im Parlament erörtert,doch die Finanzierung war strittig, die Pläne gingen bachab. Immerhin entrichtete der Bund ab 1923 der Pro Infirmis Subventionen.1925 lehnte das Stimmvolk eine Volksinitiative für eine Invaliditäts-, Alters- und Hinterlassenenversicherung(AHV)ab,stimmte aber ein halbes Jahr später einem Verfassungsartikel zu,der dem Bund erlaubte, eine Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) auszuarbeiten -unter Vorbehalt der Realisierung einer IV zu einem späteren Zeitpunkt. Doch bis dahin sollte es noch 35 Jahre dauern.
Seit 1929 Beratungsstellen
Inzwischen blieb SVfA/Pro Infirmis nicht untätig. 1929 wurdenerste Beratungsstellen eröffnet,1943 gab es schweizweit schon deren 11, heute sind es um die 5o.
Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Invaliden-versicherung 1960 veränderte sich die Rolle von Pro Infirmis:1966, bei Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen, erhielt die Pro Infirmis Subventionen, um auch finanzielle Leistungen an Menschenmit Behinderung zu entrichten.
Pro Infirmis setzt sich seither für eine bessere Betreuung von behinderten Menschen durch die Invalidenversicherung und insbesondere für Eingliederungsmassnahmen ein.Seit den 1990 er-Jahren forderte sie wie derholt eine bessere Integration und die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Mit der Verabschiedung des Behindertengleichstellungsgesetzes 2004 war das teilweise erreicht.
Die Finanzierung der Dienstleistungenerfolgtzurund6o Prozent über Leistungen der öffentlichen Hand und zu 40 Prozent aus privaten Mitteln.
Jährlich führt Pro Infirmis gemäss Jahresbericht 245 000 Beratungen durch. Sie richtet 15,8 Millionen Franken Direkthilfe aus und entlastet während 90 000 Stunden Angehörige. sda