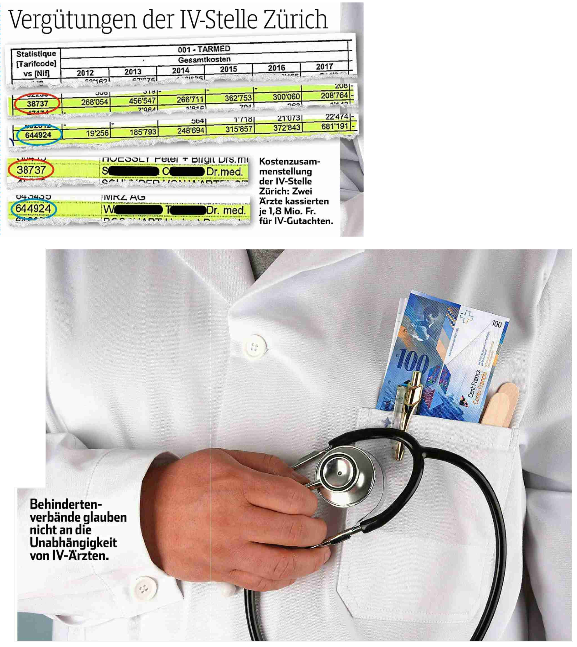(Neue Zürcher Zeitung)
Die Schweiz hat sich verpflichtet, Behinderten mehr Autonomie zuermöglichen – doch nur wenige können in der eigenen Wohnung leben
SIMON HEHLI
Johanna Ott sitzt vor dem Spiegel in ihrer Wohnung im Kulturpark in Zürich-West. Ohne Make-up aus dem Haus zu gehen, ist keine Option – doch selber schminken kann sich die 35-Jährige nicht. Ihr Assistent Jorge de la Cruz übernimmt das, wie die allermeisten Handgriffe in Otts Alltag. Wegen Sauerstoffmangel bei der Geburt ist sie körperlich schwer beeinträchtigt, sie hat keine Kontrolle über die Bewegungen ihrer Arme und Beine.
Jorge stammt aus Kolumbien, erwar dort Arzt und holt nun in der Schweiz die Ausbildung nach, um auchhier als Mediziner arbeiten zu dürfen.Er hilft Johanna Ott auch beim Essen, beim Anziehen, bei der Körperpflege – und er dolmetscht. Denn wer sie nicht gut kennt, versteht ihre Worte kaum. Johanna Ott ist völlig abhängig von ihrem Assistenten, hat aber das Sagen: Sie ist die Arbeitgeberin des Südamerikaners.
Glücklich dank Selbständigkeit
Ott kann vor allem dank dem 2012 eingeführten Assistenzbeitrag selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben. Sie bekommt von verschiedenen Sozialversicherungen ein Assistenzbudget und stellt mit dem Geld Assistenten an, die fast die ganze Woche abdecken. Jorge ist einer von derzeit sechs Beschäftigten, die sie hat. Ott ist glücklich, dass sie nicht in einem Heim leben muss. Unter der Woche verbringt sie Stunden am Computer und schreibt Kurzgeschichten oder Gedichte, indem sie das Programm mit Augenbewegungen steuert. Dass sie ihr Leben so frei gestalten kann, ist jedoch alles andere als selbstverständlich.
Johanna Ott ist einer von rund 2000 Menschen mit Behinderung im ganzen Land, die derzeit vom Assistenzbeitrag profitieren. Betroffene sollen selber bestimmen dürfen, ob sie in einem Heim oder in einer eigenen Wohnung leben möchten – das sieht auch die Uno-Behindertenrechtskonvention vor, welche die Schweiz 2014 ratifiziert hat. Die Wahlmöglichkeit ist de facto aber eingeschränkt. Laut Bundesamt für Statistik wohnen 43 000 Behinderte im Alter zwischen 15 und 64 Jahren in einer speziellen Institution oder einem allgemeinen Pflegeheim. Lange nicht alle von ihnen würden zwar in einer eigenen Wohnung zurechtkommen – doch der Kreis der Kandidaten dürfte weit grösser sein als jene rund 2000 Personen, die heute mit Assistenz leben.
Es gibt zwei gravierende Probleme:die Finanzen – und die Schwierigkeit,eigene Angestellte führen zu müssen, inklusive des Rekrutierens, des Bezahlens von Löhnen und Sozialabgaben oder des Erstellens eines Dienstplans.
Managen ist anspruchsvoll
Daniel Kasper ist Dozent an der Hochschule für Soziale Arbeit in Olten. Erhat das Modellprojekt des Vereins «Leben wie du und ich», der Johanna Ott und vier weitere Menschen mit Behinderung unterstützt, in einer Studie untersucht, die er im September an einer Tagung vorstellt. Dass die Bewohnerdes Kulturparks die Regie ihres eigenen Lebens übernehmen könnten, sähen alle sehr positiv. «Doch das Arbeitgebersein ist auch sehr anspruchsvoll und gleicht der Führung eines kleinen Unternehmens, ohne KV-Ausbildung ist das fast nicht zu machen», sagt Kasper. Entscheidend sei deshalb die Hilfe, die «Leben wie du und ich» bei der Organisation und beim Management der Assistenzteams leisten könne.
Umso schwerer haben es Menschen mit Beeinträchtigung, die beim Managen der Angestellten auf sich alleine gestellt sind. Doch für mindestens so problematisch hält Kasper die finanziellen Rahmenbedingungen. Die IV bezahlt pro Tag maximal acht Betreuungsstunden zu einem Ansatz von 33 Franken,das ist für viele Betroffene zu wenig. Den Rest sollten eigentlich kantonal geregelte Sozialversicherungen wie die Ergänzungsleistungen decken. Doch laut«Leben wie du und ich»-Projektleiterin Adelheid Arndt funktioniert das nicht:Die Fehlbeträge bei den Projektteilnehmenden lägen bei jährlich 20 000 bis 50 000 Franken, je nach Schwere der Behinderung. «Das können wir als spendenfinanzierter kleiner Verein nicht ewig tragen.»
Daniel Kasper sagt deshalb: «Das Leben mit Assistenz ist gefährdet, wenn esso weitergeht, müssen viele Betroffene zurück ins Heim.» Er kritisiert, die Behörden unternähmen zu wenig, um die Uno-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Dies hält er auch deshalb für kurzsichtig, weil er davon ausgeht, dass die Kosten für die Betreuung von Behinderten in einem Heim mindestens so hoch sind wie im Modell mit Assistenz, dies wegen der teuren Overheads in den Heimen. Wissenschaftliche Untersuchungen, die diese Vermutung belegen könnten, gibt es bis jetzt allerdings nicht.
«Administrativer Albtraum»
Auch Benolt Rey, Mitglied der Geschäftsleitung des Behindertenverbands Pro Infirmis, beobachtet «riesige» Unterschiede zwischen den Kantonen.«In der Westschweiz und im Tessin ist die Bereitschaft viel grösser, die Kosten zu decken, die über die IV-Finanzierung hinausgehen.» Das gelte auch für eine andere Alternative zu den Heimen, das begleitete Wohnen. Doch die Finanzierung sei ein «administrativer Albtraum»:Bis zu neun verschiedene Sozialsystemeteilten sich die Kosten.
Für Adelheid Arndt und ihre Kollegin Jennifer Zuber vom Verein «Leben wie du und ich» ist der politische Stillstand (siehe Box) frustrierend. «Wir haben mit unserem Projekt in Zürich bewiesen, dass ein gutes autonomes Leben mit Assistenz möglich ist, auch die gesellschaftliche Akzeptanz ist längst da»
Weil sich aber der Bund und die Kantone bei der Finanzierung den Schwarzen Peter zuspielten, drohe dem Projekt nach vier Jahren das Aus.
Als positives Zeichen wertet Arndt,dass der Zürcher Kantonsrat vor einem Jahr entschieden hat, von der Objekt-zur Subjektfinanzierung überzugehen:Künftig sollen nicht mehr Heime, in denen Menschen mit Behinderungen betreut werden, das Geld erhalten, sondern die Menschen selbst. Damit hätten alle – nicht nur jene, die heute schon mit Assistenz wohnen – die Wahlfreiheit, wie sie ihre Betreuung organisieren wollen. Schon länger ist ein solcher Systemwechsel in Bern geplant. Doch Sozialdirektor Pierre Alain Schnegg(svp.) schiebt die Umsetzung immer weiter hinaus, derzeit ist sie für 2023 vorgesehen. Grund: die Angst vor Mehrkosten in der Höhe von Dutzenden Millionen Franken.

Johanna Ott kommt nur dank der Hilfe ihres Assistenten Jorge de la Cruz im Alltag zurecht JOEL HUNN /NZ
Es fehlt Geld für Angehörige und die Nach
hhs.Die nationale Politik beschäftigt sich mit zwei Aspekten, die für die Zukunft der Assistenz wesentlich sind. Einerseits geht es um die Nachtdienste. Die IV sieht dafür eine Pauschale von 88 Franken 55 vor. Diesetiefe Vergütung verunmögliche es, geeignete Personen zu finden, kritisiert BDP-Nationalrätin Rosmarie Quadranti in einer Interpellation. Der Bundesrat verweist in seiner Antwort auf die Arbeitsgruppe «Optimierung Assistenzbeitrag», die das Bundesamt für Sozialversicherung eingesetzt hat – und die unter anderem die Frage der Nachtpauschale klären soll. Zudem pocht CVP-Nationalrat Christian Lohr darauf, dass auch Familienmitglieder von Behinderten Geld für Assistenzdienste erhalten. Aus Sicht von Benoit Rey von Pro Infirmis wäre das essenziell,um dem Ideal eines selbstbestimmten Lebens näherzukommen. «Manche Behinderte müssen in ein Heim, weil die Angehörigen auf ein Erwerbseinkommen angewiesen sind und sich nicht um sie kümmern können – das würde sich mit der Reform ändern.» Zudem könnte auch der administrative Aufwand abgegolten werden, den manche Angehörigen heute haben, weil sie das Koordinieren des Assistenzdienstes übernehmen. Die parlamentarische Initiative von Lohr fand bereits im Juni 2015 eine Mehrheit im Nationalrat; seither hat sich jedoch nichts mehr getan.