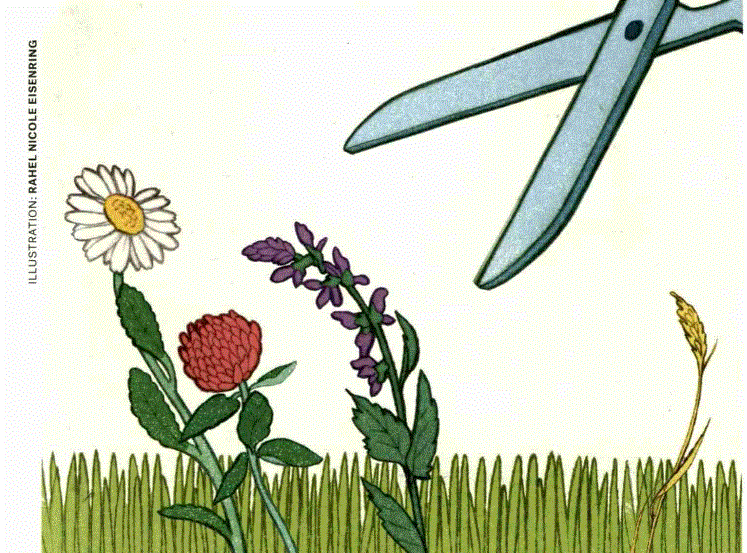(Panorama / BildungBeratungArbeitsmarkt)
Trotz vielfältiger Bemühungen stagniert die Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Das widerspricht dem breit abgestützten Ziel, Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen, ihre Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt einzubringen. Weitere Massnahmen sind angezeigt.
Von Bruno Weber-Gobet, Leiter Bildungspolitik Travail.Suisse

Arbeit trotz Handicap (Bild: Adrian Moser)
Für Menschen mit Behinderungen haben Erwerbsarbeit und Beschäftigung, wie für die meisten anderen Menschen, einen hohen Stellenwert. Denn sie bilden eine Voraussetzung für eine selbstbestimmte Lebensführung und die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe. Dabei spielt nicht nur die Existenzsicherung eine Rolle. Auch soziale Anerkennung oder das Gefühl, gebraucht zu werden, sind häufig mit der Integration in den Arbeitsmarkt verbunden. Fehlen diese, kann das für die Betroffenen nicht nur eine ökonomische Prekarisierung zur Folge haben, sondern auch soziale Isolation, verbunden mit dem Verlust von Selbstvertrauen und Resignation.
Dass es dies zu verhindern gilt, ist seit einigen Jahren ein breit abgestütztes Anliegen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – nicht nur aus sozialer, sondern auch aus volkswirtschaftlicher und rechtlicher Perspektive. Denn einerseits ist die Berentung von Menschen mit Behinderungen ein Kostenfaktor im System der sozialen Sicherheit. Andererseits ist es im Kontext des Fachkräftemangels nicht angezeigt, das inländische Potenzial an Arbeitskräften, zu dem auch Menschen mit Behinderungen gehören, nicht optimal zu nutzen. Ausserdem existieren internationale und nationale Rechtsgrundlagen, die Menschen mit Behinderungen den Zugang zum Arbeitsmarkt ebnen sollen. So ist das Recht auf Arbeit spezifisch für Personen mit Behinderungen in Artikel 27 des UNO-Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention) festgehalten. Für die Schweiz ist die Behindertenrechtskonvention am 15. Mai 2014 in Kraft getreten.
Stagnierende Erwerbsbeteiligung
Obwohl in den letzten Jahren vielfältige Massnahmen zur Stärkung der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen ergriffen wurden, insbesondere im Rahmen der Invalidenversicherung, hat eine Evaluation des Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (BehiG) gezeigt, dass sich die Erwerbschancen der Betroffenen seit Inkrafttreten 2004 nicht substanziell verbessert haben. Diese ernüchternde Bilanz widerspiegelt sich in den Zahlen des Bundesamts für Statistik: 2015 waren von den Menschen mit Behinderungen im Erwerbsalter nur 68 Prozent erwerbstätig (Menschen ohne Behinderungen: 84%).
Gründe für diese Stagnation sind auf verschiedenen Ebenen auszumachen. Zum einen mag es an individuellen Voraussetzungen von Menschen mit Behinderungen liegen, welche eine Integration in bestimmten Fällen erschweren. Zum anderen sind es gesellschaftliche Rahmenbedingungen wie etwa soziale Barrieren (Berührungsängste, Zweifel an der Leistungsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen) oder lückenhafte Rechtsgrundlagen, welche einem Zugang zum Arbeitsmarkt nicht förderlich sind.
Das BehiG der Schweiz sieht zwar Massnahmen zur Verbesserung der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen vor, das betrifft aber nur Arbeitsver hältnisse, die durch das Bundespersonalgesetz geregelt sind. Auf privatrechtliche Arbeitsverhältnisse findet es keine Anwendung, obwohl der Bund hierzu über die nötige Gesetzgebungskompetenz verfügt. Zudem wurden die allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts bis heute nie erfolgreich angewandt, um Diskriminierungen von Menschen mit Behinderungen in der Privatwirtschaft zu beseitigen.
Ein Blick ins Ausland zeigt, dass andere Länder eine Beschäftigungspflicht (gesetzliche Quote) für Unternehmen eingeführt haben, um die Arbeitsmarktbeteiligung von Menschen mit Behinderungen zu erhöhen. Der jeweilige einzuhaltende Prozentsatz (zwischen 2 und 7 Prozent) ist von Land zu Land unterschiedlich und gilt ab einer bestimmten, ebenfalls unterschiedlichen Anzahl Beschäftigter in einem Betrieb. In den meisten Ländern gelten die Quoten sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. In Deutschland sind öffentliche Verwaltungen und Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitenden seit 1974 verpflichtet, mindestens 5 Prozent ihrer Arbeitsplätze mit Menschen mit Behinderungen zu besetzen. Tun sie es nicht, ist eine Ausgleichsabgabe fällig, die im Umlageverfahren an die Unternehmen verteilt wird, welche Menschen mit Behinderungen einstellen. Mit diesem «Eingliederungszuschuss» können Arbeitgebende zum Beispiel Umbauten oder andere Integrationsmassnahmen finanzieren. Das zeigt Wirkung: Im Jahr 2003 lag der Anteil von Menschen mit Behinderungen an der erwerbstätigen Bevölkerung noch bei 4 Prozent, seither ist er auf 4,7 Prozent gestiegen. Auch in der Schweiz stand die Einführung einer Quote bereits auf der politischen Agenda; sie wurde aber vom Parlament stets abgelehnt.
Integrationsbemühungen verstärkt
Für eine gelingende berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen werden in der Schweiz von verschiedenen Akteuren immer wieder Projekte lanciert und Massnahmen ergriffen. Eine Bilanz zeigt, dass die Bemühungen in den letzten zehn Jahren sogar deutlich intensiviert wurden.Für die Massnahmen, welche sich an das Individuum richten, ist in erster Linie die Invalidenversicherung (IV) zuständig. Mit der 4. und insbesondere der 5. sowie der 6. IV-Revision hat die IV einen Paradigmenwechsel von der Rentenversicherung hin zu einer Eingliederungsversicherung eingeleitet. «Eingliederung vor Rente» und «Eingliederung aus Rente» waren dabei die treibenden Leitsätze. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses befindet sich eine weitere Änderung der IV im Parlament, der Bundesrat bezeichnet das Geschäft als «Weiterentwicklung der IV». Das Strategieziel der neuen Reformvorlage besteht nun nicht mehr in der finanziellen Sanierung der IV, sondern in der Weiterentwicklung der IV-Leistungen im Dienste der Integration. Der Invalidisierung vorbeugen und die Eingliederung verstärken sind die Hauptziele der Vorlage. Als Zielgruppe stehen Kinder und Jugendliche sowie Versicherte mit psychischen Beeinträchtigungen im Mittelpunkt. Besonderes Augenmerk gilt den Übergängen von der Schule in die Arbeitswelt. Zurzeit zeichnet sich ab, dass eine Mehrheit der nationalrätlichen Sozialkommission auf Sparelemente nicht verzichten möchte.
Für Massnahmen, welche die Rahmen- bedingungen betreffen, zum Beispiel den Abbau von Zugangshindernissen und die Ausgestaltung eines Arbeitsumfeldes, das den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen Rechnung trägt, kommt Akteuren wie dem Bund als Arbeitgeber, den Kantonen, der Privatwirtschaft und den Sozialpartnern eine Schlüsselrolle zu. Ein paar Beispiele:
– Das privatwirtschaftliche Informationsportal compasso.ch berät Arbeitgebende zu Fragen der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen. Es steht unter dem Patronat des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes.
– Gesamtarbeitsverträge (GAV) haben ein spezifisches Potenzial zur Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderungen. Mit ihnen lassen sich Lösungen treffen, die der Situation einer Branche oder eines Unternehmens besser gerecht werden als gesetzliche Vorgaben, die für alle gleichermassen verbindlich sind. Eine Studie von Travail.Suisse zeigt, welche Regelungen in GAV zur Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderungen vorliegen (zum Beispiel im Zusammenhang mit der Festlegung von Löhnen angesichts einer verminderten Produktivität) und wo Lücken und Probleme bestehen. Die Studie macht Vorschläge an die Sozialpartner, um die Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderungen via GAV zu verbessern.
– Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) hat im Auftrag des Bundesrates 2017 – für einen Zeitraum von rund vier Jahren – das Programm «Gleichstellung und Arbeit» lanciert. Es soll die Gleichstellung mit Finanzhilfen für Projekte gezielt fördern. Damit ergänzt es die Massnahmen zur Förderung der beruflichen Integration im Rahmen der IV.
– An der Nationalen Konferenz zur Arbeits- marktintegration von Menschen mit Behinderung vom Dezember 2017 wurden eine Erklärung verabschiedet und Handlungsansätze vorgestellt, welche die Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderungen fördern sollen.