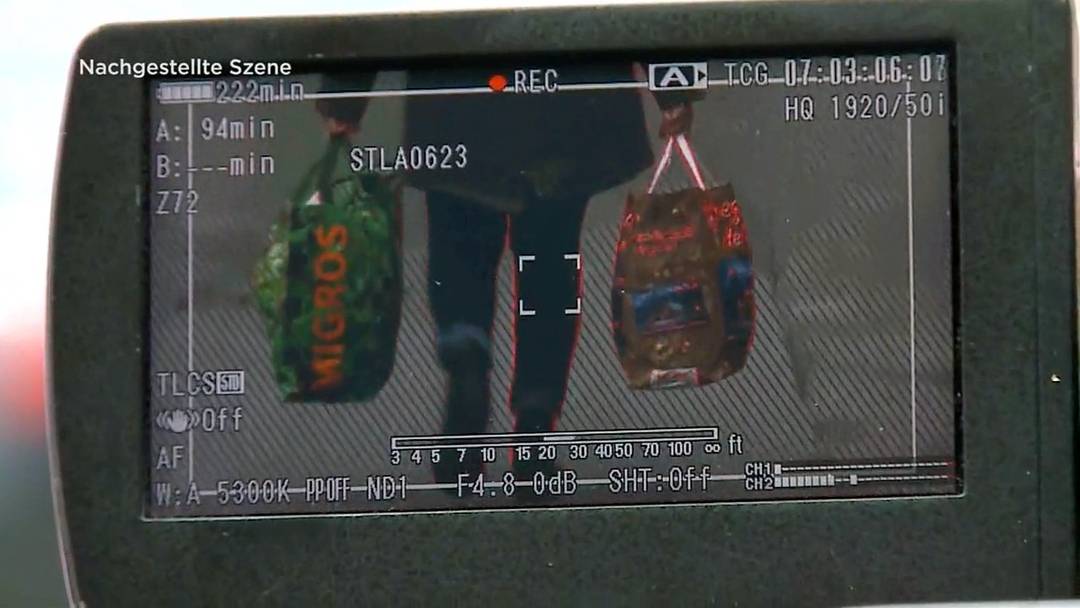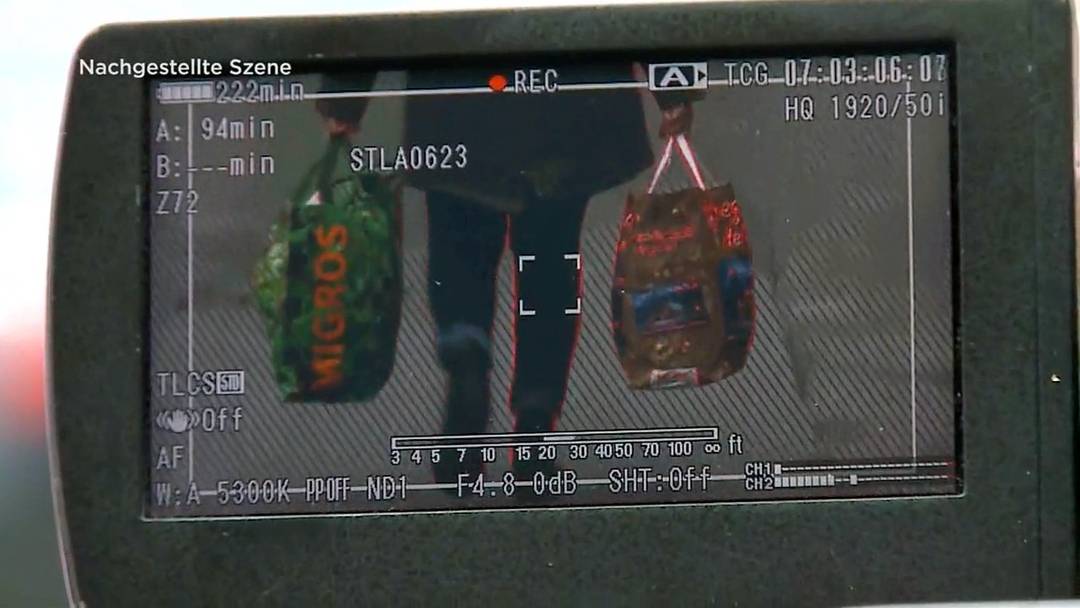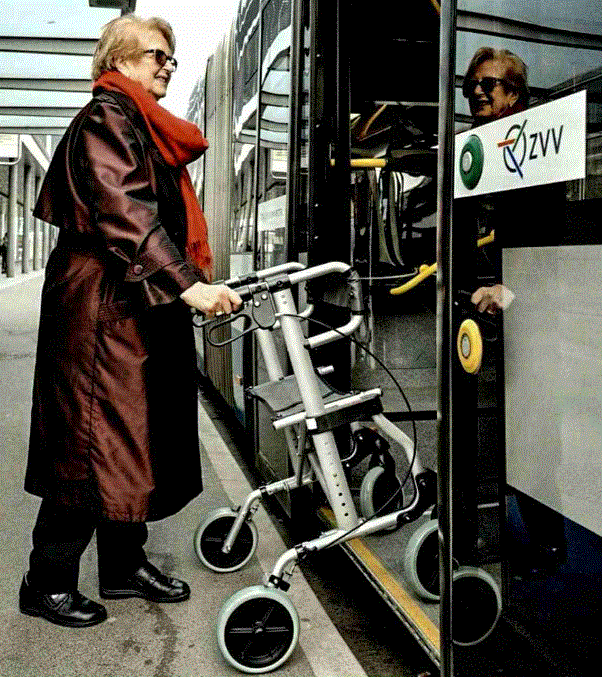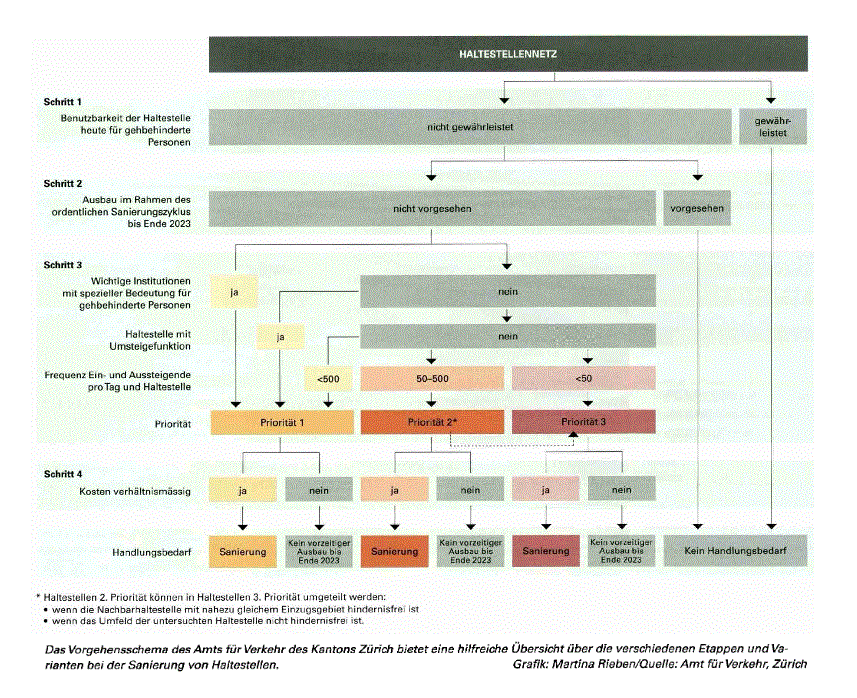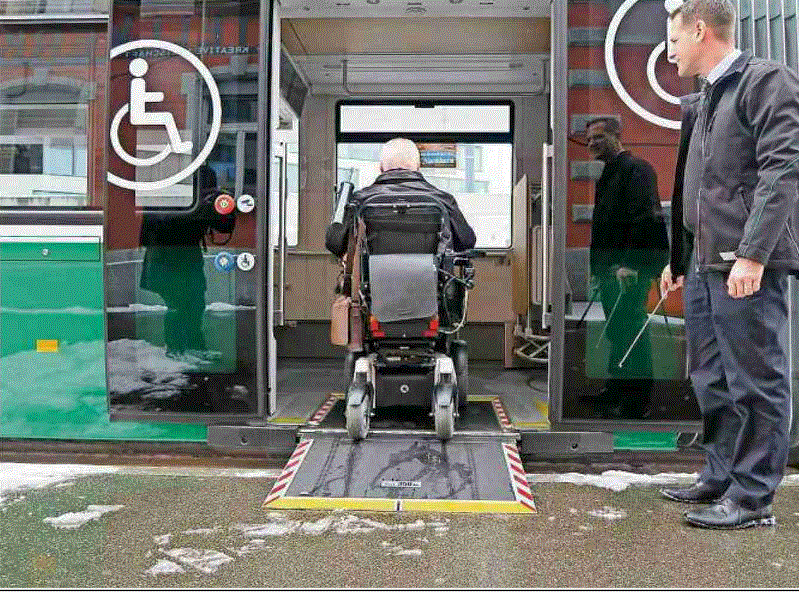(Schweizer Versicherung)
Eine Praxisänderung des Bundesgerichts zur Zahlungs-verpflichtung der IV bei Depressionen wirft Wellen.Von Clemens Furrer
Depressionen sind eine weit verbreitete Krankheit gerade auch in wirtschaftsintensiven Ländern wie der Schweiz. Während wohl jeder schon Phasen der Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit und Lustlosigkeit durchgemacht hat, kann sich dies bei manchen zu einer veritablen Krankheit verschlimmern, die es für sie unmöglich erscheinen lässt, einem Erwerbseinkommen nachzugehen. In solchen Fällen springt die Invalidenversicherung (IV) ein. Allerdings war das bisher ein heikles Unterfangen, denn auch die IV steht unter Spardruck und der Nachweis nicht mathematisch exakt beweisbarer Krankheiten wie ungeklärte Schmerzen oder Depressionen war im Einzelfall oft schwierig zu erbringen.
Die rigide Rechtsprechung zu unerklärlichen Schmerz- störungen hatte das Bundesgericht bereits 2015 geändert. Nun zieht es auch bei Depressionen nach. Während Patienten mit leichten bis mittelschweren Depressionen bisher nur dann eine IV-Rente erhalten hatten, wenn ihr Leiden als therapieresistent gilt, lässt das Bundesgericht nun ein «strukturiertes Beweisverfahren» zu und betrachtet somit das tatsächliche berufliche Leistungsvermögen und nicht nur die medizinische Diagnose bzw. Therapierbarkeit.
Von Rückenbeschwerden zur Depression Der damals 38-jährige Aslan (Name fiktiv) meldete sich im Jahr 2004 wegen Rückenbeschwerden bei der IV an und erhielt eine Rente. Im Jahr 2012 liess die IV Aslan begutachten. Nachdem auch der Regionale Ärztliche Dienst dazu Stellung genommen und eine Aktenbeurteilung aus psychiatrischer Sicht abgegeben hatte, verfügte die IV im August 2016 die Renteneinstellung, wogegen Aslan sich bis vor Bundesgericht wehrte. Das Bundesgericht kommt in seinem neuen Urteil 8C_130/2017 vom 30.11.2017 zum Schluss, sämtliche psychischen Erkrankungen sollten einem strukturierten Beweisverfahren unterzogen werden, um die funktionellen Folgen sämtlicher psychischer Befunde anhand des strukturierten Beweisverfahrens gesamthaft zu beurteilen.
Vor Bundesgericht war unbestritten, dass aus somatischer Sicht keine Arbeitsunfähigkeit vorliegt. Streitig war, ob die Renteneinstellung zu Recht erfolgte. Der depressiven Störung massen die Gutachter in Bezug auf die Arbeitsfähigkeit keine primäre Bedeutung bei. Sie begründeten eine 100-prozentige Arbeitsunfähigkeit vorrangig mit der diagnostizierten chronischen Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren. Die kantonale Vorinstanz erkannte dem Gutachten vollen Beweiswert zu, wich dabei jedoch von der attestierten Arbeitsu fähigkeit ab.
Arbeitsfähig trotz Störung?
Fraglich ist vor Bundesgericht, ob die psychischen Beschwerden eine 100-prozentige Arbeitsunfähigkeit begründen. Nach Auffassung des Bundesgerichts bestätigt die Weiterentwicklung der Diagnosen, dass die diagnostische Einordnung einer psychischen Störung allein das objektiv bestehende tatsächliche Leistungsvermögen eines Patienten nicht festlegt.
In der Praxis findet sich im Nachgang zu BGE 141 V 281 der Schluss, es handle sich, wenn die Diagnosekriterien keinen bestimmten Schweregrad der Befunde verlangten, um ein leichtgradiges Krankheitsgeschehen, das von vornherein keine rechtserhebliche Einschränkung der Arbeitsfähigkeit bewirken könne. Da vorliegend die Arbeitsunfähigkeit durch eine chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren mithin also eine Störung ohne Bezug zu einem Schweregrad der Befunde in den Diagnosekriterien begründet wird, bedarf dies in den Augen des Bundesgerichts einer grundsätzlichen Klärung. Bei der chronischen Schmerzstörung wird ein über Monate bestehender Schmerz in mehreren anatomischen Regionen beschrieben. Die Schmerzen werden durch eine Wechselwirkung von körperlichen und psychischen Faktoren hervorgerufen. Psychische Faktoren haben dabei einen wesentlichen Einfluss auf Schweregrad und Aufrechterhaltung der Schmerzen.
Nach neuer Überzeugung des Bundesgerichts fehlt der Diagnose einer chronischen Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren ein Bezug zum Schweregrad der Erkrankung. Idee des durch Indikatoren geleiteten strukturierten Beweisverfahrens ist es, danach zu fragen, ob die vorhandenen Funktionseinbussen durch die erhobenen Befunde abgedeckt und erklärbar sind. Die angegebene Beeinträchtigung in den verschiedenen Funktionsbereichen darf dabei nur durch die diagnoseerheblichen Befunde begründet sein. Zentral ist die Notwendigkeit des «diagnoseninhärenten Schweregrads» mit der Schlussfolgerung, dass – wie das Bundesgericht mutmasst – «deutlich zu häufig eine anhaltende Schmerzstörung diagnostiziert» wird, ohne dem geforderten Schweregrad genügend Beachtung zu schenken. Nur wo bereits in den Diagnosekriterien ein Bezug zum Schweregrad gefordert wird, erlaubt nach höchstrichterlicher Überzeugung ein nicht erreichter Schweregrad gegebenenfalls bereits den Ausschluss einer krankheitswertigen Störung. Indes will das Bundesgericht dies nicht auf sämtliche psychiatrischen Diagnosen verallgemei- nernd anwenden. Fehlt in der Diagnose die Schweregradbezogenheit, sieht das Gericht die Schwere der Störung in ihrer rechtlichen Relevanz erst bei deren funktionellen Auswirkunge
Arbeitsfähigkeit im Fokus Das Bundesgericht sieht aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht nicht die Schwere einer Erkrankung als entscheidend, sondern deren Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit. Selbst dort, wo Ärzte therapeutische Massnahmen eruieren, stellt sich nach Auffassung des Gerichts im Sozialversicherungsrecht einzig die Frage der Arbeitsfähigkeit. Je nach Krankheitsbild, so das Gericht jetzt neu, bestehe trotz Therapiebedarf eine erwerblich verwertbare Leistung. Das Gericht veranschaulicht diese Überlegung exemplarisch anhand abnormer Gewohnheiten oder Störungen der Sexualpräferenzen. Je nach Ausprägung ist selbst für den Laien eine schwere psychische Störung erkennbar und dennoch drängt sich ein Bezug zur Arbeitsunfähigkeit nicht auf. Nach neuer höchstrichterlicher Lesart ist es somit verfehlt, ein Leiden als leicht einzustufen, weil diagnostisch kein Bezug zum Schweregrad gefordert ist und ihm schon deshalb eine versicherungsrechtlich relevante Einschränkung der Arbeitsfähigkeit abzusprechen.
Der davon zu unterscheidende funktionelle Schweregrad einer Störung, der sich nach deren konkreten funktionellen Auswirkungen und insbesondere danach beurteilt, wie stark die versicherte Person in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen schmerzbedingt beeinträchtigt ist, überschneidet sich da- bei teilweise mit den Ausführungen zur Diagnosestellung. Somit lässt das Bundesgericht auch bei schweren psychischen Leiden nicht automatisch auf eine ausgeprägte funktionelle Einschränkung schliessen.
Nach neuer höchstrichterlicher Auffassung resultiert unabhängig von der klassifikatorischen Einordnung einer Krankheit aus einer Diagnose allein also keine verlässliche Aussage über das Ausmass der mit dem Gesundheitsschaden zusammenhängenden funktionellen Leistungseinbusse bei psychischen Störungen. Entscheidend bleibt vielmehr die Frage der funktionellen Auswirkungen einer Störung. Daher kann nach nun neuer Lesart des Gerichts eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsschätzung, zumindest ohne einlässliche Befassung mit den spezifischen normativen Vorgaben und ohne entsprechende Begründung, den rechtlich geforderten Beweis des Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit nicht erbringen.
Abklärung der funktionellen Folgen
Das Bundesgericht stellt mit Verweis auf Urteil 8C_841/2016 klar, dass ab jetzt auch affektive Störungen, einschliesslich der leichten bis mittelschweren depressiven Erkrankungen, einzelfallweise dem strukturierten Beweisverfahren unterstellt werden. Somit sind grundsätzlich sämtliche psychischen Erkrankungen einem strukturierten Beweisverfahren zu unterziehen. Diese Abklärungen enden stets mit der Rechtsfrage, ob und in welchem Umfang die ärztlichen Feststellungen anh der rechtserheblichen Indikatoren auf Arbeitsunfähigkeit schliessen lassen. Aufgabe der Rechtsanwendung ist also nicht, die medizinischen Befunde einzeln oder separat zu prüfen, sondern gesamthaft die funktionellen Folgen einer oder mehrerer psychischer Leiden zu würdigen.
Das Gutachten im Fall von Aslan gibt nach Meinung des Bundesgerichts nicht hinreichenden Aufschluss über die im Vordergrund stehenden Standardindikatoren. Eine schlüssige Beurteilung der Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit war im konkreten Fall nicht möglich. Das Gericht ordnete daher ein neues interdisziplinäres Gutachten an und wies den Fall an die Vorinstanz zurück.