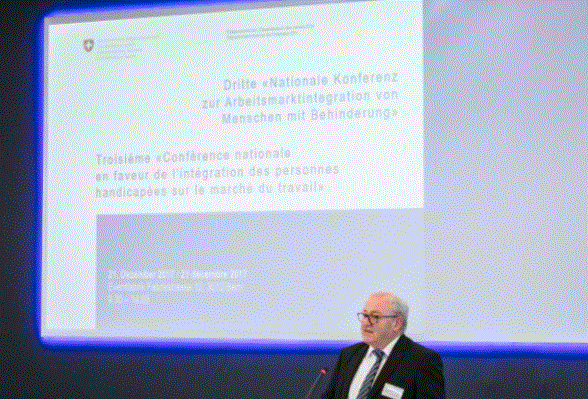Die Zürcher Gemeinde Neerach macht mit einem speziellen Fall, den es so eigentlich nicht geben dürfte, von sich reden.
Der Brief kam vor wenigen Tagen. Nicht ganz unerwartet – und doch mussten Daniel Hess und Angela Peter, die Eltern des kleinen Stefan Peter (Namen geändert), leer schlucken. Ab dem 1. Januar kommen massive Kosten auf das Paar zu: Mehr als 8000 Franken sollen sie jeden Monat für ihren knapp dreijährigen Sohn zahlen.
Stefan wohnt seit März 2016 in einem Heim für schwerstbehinderte Kinder. Bislang zahlten die Eltern einen Beitrag von 30 Franken pro Tag an Verpflegung und Kleidung. Nun überbürdet die Gemeinde Neerach der Familie die gesamte Versorgertaxe von 245 Franken pro Tag. So beschloss es der Gemeinderat. Neerach hat einen Steuerertrag von 12 Millionen Franken jährlich und einen Steuerfuss von 76 Prozent. Der Entscheid löst bei Kantonsräten Kopfschütteln aus. «Stossend» sei er, findet Sabine Wettstein (FDP, Uster); Corinne Thomet (CVP, Kloten) sagt: «Das ist nicht nachvollziehbar. Die Gemeinde bereichert sich auf Kosten der Eltern.» Auch Peter Hummel, Leiter von Stefans Kinderheim Weidmatt in Wolhusen LU, hält die Forderung der Gemeinde für unzumutbar: «Für mich ist es klar eine öffentliche Aufgabe, einem solchen Kind die bestmöglichen Bedingungen zu finanzieren.»
Nicht der Wille des Kantonsrats
Die Gemeinde begründet den Entscheid mit dem revidierten Heimgesetz des Kantons, das die Stimmbürger am 24. September guthiessen und das Anfang 2018 in Kraft tritt. Demnach müssten die Eltern die Versorgertaxe zahlen; nur wenn deren finanzielle Lage das nicht zulasse, dürfe die Gemeinde einspringen. Dazu sagt Moritz Spillmann (SP, Ottenbach), Präsident jener Kommission im Kantonsrat, welche die Revision ausführlich beraten hat: «Dass Eltern die gesamten Taxen zahlen müssen, war klar nicht die Absicht der Revision. Weder wir noch der Kanton gingen davon aus, dass es solche Fälle gibt.» Daniel Hess und Angela Peter sind der Fall, den es eigentlich nicht geben dürfte.
Um das zu verstehen, muss man zurückblenden. Jahrzehntelang zahlte der Kanton Kinderheimen einen nicht kostendeckenden Betriebsbeitrag. Die restlichen Kosten verrechnete er als Versorgertaxen den Eltern. Diese Taxen lagen zwischen 150 und 300 Franken am Tag. In aller Regel kamen faktisch die Wohngemeinden für die Taxen auf, denn die allerwenigsten Familien konnten sich diese leisten. Der Kanton Zürich hielt an seiner Praxis noch fest, nachdem andere Kantone längst dazu übergegangen waren, den Eltern nur noch einen Nebenkostenbeitrag von 15 bis 40 Franken am Tag zu verrechnen. Erst 2013 lancierte der Regierungsrat die Arbeit am neuen Gesetz, das die Eltern von der Beitragspflicht grösstenteils befreien und die Heimkosten solidarisch auf Kanton und Gemeinden aufteilen sollte.
Die alte Regelung behielt man vorerst bei. Doch im Frühjahr 2016 kippte das Bundesgericht die geltende Praxis. Es gebe keine Rechtsgrundlage, den Eltern und in der Folge den Gemeinden die Heimkosten aufzubürden. Diese habe der Kanton zu tragen. Das allerdings hätte für den Kanton massive Mehrkosten zur Folge gehabt, weshalb man eilends das geltende Gesetz revidierte – wohl wissend, dass ein neues in Arbeit war.
«Ein Entgegenkommen wäre Willkür», schreibt der Gemeinderat. Den «angeblichen Willen» des Kantonsrats könne er nicht berücksichtigen.
«Ziel dieser Übergangslösung war es, die bisherige Kostenaufteilung zwischen Gemeinden und Kanton beizubehalten, bis das neue Gesetz in Kraft tritt», sagt Kommissionspräsident Spillmann. Aber niemand wollte den Eltern neue Kosten auferlegen.» Diesen politischen Willen habe der Kantonsrat klar geäussert, sagt Spillmann, und dem pflichten Corinne Thomet und Sabine Wettstein bei. Denn im November verabschiedete der Rat das neue Gesetz mit grossem Mehr, es soll 2021 in Kraft treten. Ab dann wird es nicht mehr möglich sein, Eltern mehr als 30 Franken pro Tag für ein Heimkind zu verrechnen. «Vor diesem Hintergrund ist das Vorgehen der Gemeinde Neerach noch stossender», sagt Moritz Spillmann, «selbst wenn es dem Buchstaben nach nicht unrechtmässig ist. Die Gemeinde hat einen Ermessensspielraum, den sollte sie nutzen.» Das sieht auch André Woodtli, Chef des für Heimplatzierungen zuständigen kantonalen Amts für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, so.
Die Gemeinde widerspricht in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem TA. «Ein Entgegenkommen wäre Willkür», schreibt der Gemeinderat. Den «angeblichen Willen» des Kantonsrats könne er nicht berücksichtigen.
Enorm aufwendige Pflege
Von all dem konnten Daniel Hess und Angela Peter noch nichts wissen, als sie kurz nach Stefans Geburt zu ahnen begannen, dass mit dem Kleinen etwas nicht stimmte. Zwar trank er wie andere Babys, aber sein Blick war leer, die Bewegungen auch nach einigen Lebenswochen noch kaum zielgerichtet.
Stefan war ein halbes Jahr alt, als er erstmals epileptische Anfälle bekam. Da war den Eltern längst klar, dass ihr Kind in mehrfacher Hinsicht beeinträchtigt sein musste. Ein Hirnscan brachte schliesslich die niederschmetternde Diagnose: Stefan hat zwar ein voll ausgebildetes Stammhirn und intakte Organe, sein Grosshirn aber ist nicht ausgebildet. Einfachste Bedürfnisse wie Schmerz und Hunger spürt der Knabe, er reagiert auch auf Körperkontakt. Aber was er genau wahrnimmt, weiss niemand. Zielgerichtete Bewegungen sind ihm nahezu unmöglich. Stefans Pflege ist enorm aufwendig. Nachts muss er alle paar Stunden umgelagert werden, damit sich keine Druckstellen bilden. Das Füttern mit Babybrei oder Milch braucht viel Zeit, da Stefan den Schoppen nicht halten kann. Seine Epilepsie ist trotz Medikamenten nur schwer zu kontrollieren. Manchmal hat der Bub schmerzhafte Muskelkrämpfe, manchmal schreit er stundenlang. Ist er zufrieden, strahlt er. Doch aktiv ein Lächeln auslösen können seine Eltern und seine Betreuer nicht.
Trotzdem pflegten Vater und Mutter das Baby anfangs zu Hause. «Ich war schon nach einem halben Tag jeweils völlig erschöpft», erzählt Hess. «Nicht weil ich besonders viel mit Stefan gemacht hätte. Aber es ist extrem kraftraubend, wenn ein Kind auf keinen Reiz reagiert, wenn sein Verhalten völlig unvorhersehbar ist.» Schliesslich mussten die Eltern sich eingestehen: Sie waren mit ihren Kräften am Ende. Und da war ja auch noch Stefans Schwester, zehn Jahre älter als der Kleine. «Unsere Familie würde daran kaputtgehen, wenn wir Stefan weiter daheim betreuen würden», sagt seine Mutter. «Und es fehlen uns auch die medizinischen und sonderpädagogischen Fachkenntnisse.» Eine Einschätzung, die Heimleiter Hummel bestätigt: «Stefan ist selbst für unsere Verhältnisse schwer behindert. Ihn zu pflegen, ist für eine Familie nicht machbar. Seine Gesundheit wäre gefährdet.»
Gemeinde rechnete mit fiktivem Einkommen
Im Herbst 2015 beantragten die Eltern bei der Gemeinde eine Kostengutsprache, damit Stefan ins Heim ziehen konnte. Das Verfahren zog sich hin, schliesslich erklärte sich Neerach bereit, die Heimplatzierung zu bewilligen – sofern sich seine Eltern mit 130 Franken pro Tag an den Versorgertaxen beteiligten. Hess und Peter wehrten sich, verlangten Berechnungsgrundlagen. Und bekamen diese im Februar 2016 auch: Die Gemeinde Neerach kalkulierte mit einem fiktiven Einkommen von 35’000 Franken im Monat.
Tatsächlich verdient das Paar deutlich weniger, gut 19’000 Franken netto. Doch Neerach kalkuliert auch den Eigenmietwert für das Haus der Familie sowie einen Vermögensverzehr von 8700 Franken mit ein. «Wir haben dieses Vermögen nicht», sagt Daniel Hess. «Es steckt in unserem Haus.» In dem Schreiben der Gemeinde heisst es ferner, mit dieser «komfortablen» Situation könne das Paar auch die gesamten Kosten von 7350 Franken im Monat tragen. Aber weil dem Gemeinderat das Kindswohl wichtig sei, verlange er nur 3900 Franken monatlich. Und weiter: «Bitte beachten Sie, dass viele Familien mit einem viel tieferen Monatseinkommen auskommen müssen.»
Schliesslich willigten Hess und Peter im März 2016 ein, vorerst 3900 Franken zu zahlen. «Wir fühlten uns erpresst, aber wir hatten letztlich keine Wahl», sagt Angela Peter, «wir waren am Ende.» Das Paar hatte vor, sich später zu wehren. Doch dann kamen die erwähnten Entscheide von Verwaltungs- und Bundesgericht. Und Neerach zog sich ganz aus der Verantwortung für Stefan zurück, fortan zahlte der Kanton. Für die Eltern hiess das, dass sie noch 30 Franken am Tag beizusteuern hatten.
Keine Illusionen
Doch jetzt, mit der Revision des geltenden Gesetzes, hat sich die Lage geändert. Und Neerach verlangt von den Eltern per Anfang Jahr die volle Versorgertaxe sowie die Nebenkosten – vom Kindswohl ist im neusten Gemeinderatsbeschluss keine Rede mehr, ebenso wenig von einem Entgegenkommen. Zwar steht da, «sollten die Eltern nicht in der Lage sein, die Kosten vollumfänglich zu tragen, ist mit der Gemeindeverwaltung Kontakt aufzunehmen». Doch Peter und Hess machen sich keine Illusionen: «Am Telefon signalisierte die Gemeindeschreiberin keine Gesprächsbereitschaft.»
Wie es nun weitergehen soll, weiss das Paar noch nicht. Klar ist: Hält die Gemeinde am Beschluss fest, würde das mehr als drei Fünftel ihres Einkommens wegfressen. «Wie wir das stemmen sollen, weiss ich nicht», sagt Angela Peter. Das Paar will nun rechtlich gegen die Gemeinde vorgehen. «Es kann doch nicht im Interesse der Gemeinde sein, dass wir unser Haus verkaufen müssen, nur weil wir das Pech haben, ein behindertes Kind zu haben.»
Source: Tages-Anzeiger