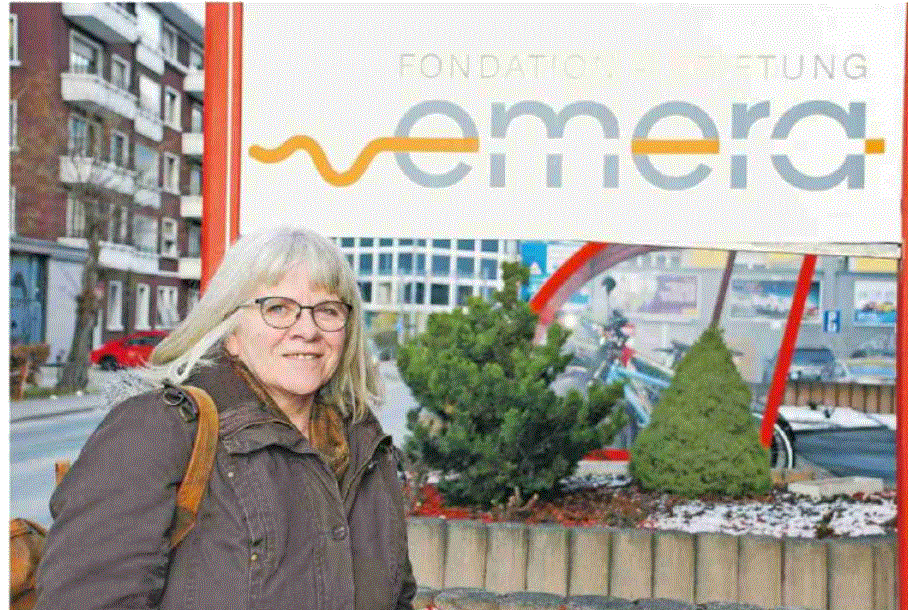Die verschärfte IV-Praxis trägt vermutlich zu den Finanzproblemen der Zentrumsgemeinden bei. Ein GLP-Kantonsrat fordert den Regierungsrat auf, dagegen vorzugehen. Dieser sieht sich dazu ausserstande, auch bewertet er die IV-Praxis positiver.
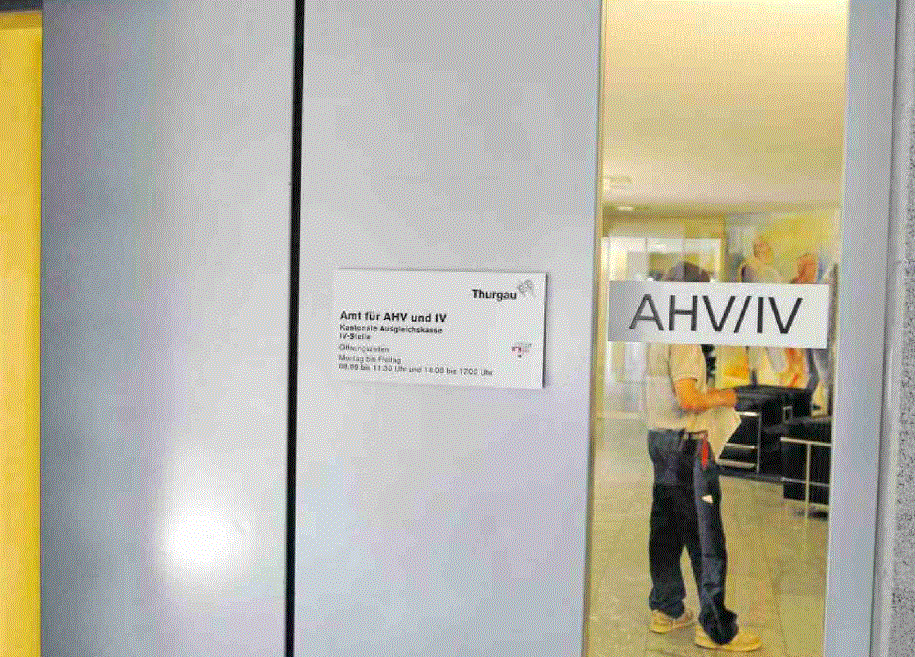
Thomas Wunderlin
Behinderte finden nur schwer eine Stelle, besonders wenn sie sich aus psychischen Gründen mit einer geregelten Arbeit schwer tun. Nur wenige Arbeitgeber geben einem Bewerber eine Chance, der sich kaum durch Tugenden wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit auszeichnet.
Klein ist aber auch deren Chance eine Rente der Invalidenversicherung (IV) zu erhalten. Denn seit der 2008 in Kraftgetretenen 5. IV-Revision gilt die Devise «Eingliederung statt Rente». Nach Ansicht des Romanshorner GLP-Kantonsrats Hanspeter Heeb ist die Revision jedoch gescheitert. Der Rentenverlust oder die Ablehnung eines IV-Antrags bedeute in allzu vielen Fällen, dass sich die Betroffenen an die Sozialhilfe wenden mussen. Dabei bezieht sich Heeb auf die Psychiaterin Doris Brühlmeier-Rosenthal aus Schlieren, nach deren Erkenntnis ausgemusterte und von der IV zurückgewiesene Patienten dem «sozialen Tod» nahe rücken.
Gemäss einer Umfrage unter Berufskollegen in den Kantonen Zürich und Aargau, deren Ergebnis Brühlmeier in der «Schweizerischen Ärztezeitung» publizierte, führte die Aufhebunder IV-Rente in 93 Prozent der Fälle zu Sozialamtsabhängigkeit, vermehrter Krankheit, Hospitalisationen, Armut oder vollkommener Erwerbsunfähigkeit. Die Ablehnung eines Rentengesuchs hatte in 60 Prozent der Fälle ähnlich negative Folgen. Brühlmeier schreibt deshalb von einer «humanitären Katastrophe».
Laut Heeb ist die Umfrage bisher die einzige Quelle zum Thema. Aufgrund einer Interpellation von ihm und 47 Mitunterzeichnern hat der Regierungsrat kürzlich einige Zahlen zur Auswirkung der IV-Revision im Thurgau veröffentlicht. Demnach hat die 5. IV-Revision tatsächlich massive Auswirkungen. Im Jahr 2005 sind nur 28 Prozent von 1456 eingereichten Gesuchen abgelehnt, dafür 72 Prozent gutgeheisse worden. Im Jahr 2016 hat sich das Bild gründlich verändert: von 1823 Gesuchen sind 66 Prozent abgelehnt und lediglich 33 Prozent gutgeheissen worden. Die Gesamtzahl der IV-Rentner im Thurgau ist nach Regierungsangaben seit 2011 von 7345 auf 7119 leicht zurückgegangen. 360 Renten sind in dieser Zeit aufgehoben, 159 gekürzt worden.
Viele der von Heeb eingeforderten Zahlen sind laut Regierungsrat nicht verfügbar oder wären nur durch einen unverhältnismässig hohen Aufwand zuerhalten; dabei handelt es sich vor allem um die Aufschlüsselung nach Gemeinden. Rund 3300 verweigerte und aufgehobene Renten Ergänzt durch eigene Berechnungen kommt Heeb zum Schluss, dass im Thurgau heute 3200 bis 3300 Personen leben, deren IV-Gesuch abgelehnt oder deren Rente aufgehoben worden ist.
Wie viele davon den Weg zurück in den Arbeitsmarkt gefunden haben, ist offen. Der Analogschluss zur erwähnten Umfrage lässt annehmen, dass der grösste Teil in der Sozialhilfe gelandet ist. Für Heeb besteht weiterhin der Verdacht, dass die Thurgauer Zentrumsgemeinden aufgrund der restriktiven Praxis der IV-Stelle seit 2009 Millionenbeiträge aufwenden müssen. «Es ist ja augenfällig, dass genau ab diesem Zeitpunkt in allen Zentrumsgemeinden auch die Sozialkosten markant zugenommen haben.» Die aktuelle Praxis der IV-Stelle sei offensichtlich nicht zielführend und koste den Kanton und die Zentrumsgemeinden Millionenbeträge; Heeb rechnet dabei auch Steuerausfälle und höhere Ausgaben für Prämienverbilligungen ein.
Der Regierungsrat müssedeshalb auf die IV-Stelle einwirken, dass sie ihre Praxis ändere und sich um eine «echte Arbeitsintegration» bemühe. Dazu verpflichte auch die UN-Behindertenkonvention, die seit 2014 in Kraft sei und die Eingliederung Behinderter in den Arbeitsmarkt verlange. In seiner Interpellationsantwort weist der Regierungsrat ein solches Ansinnen zurück. Der Kanton habe keine Weisungsbefugnis gegenüber der IV-Stelle. Diese habe auch nur einen «sehr geringen Ermessensspielraum», denn sie sei ein «Durchführungsorgan des Bundes» und werde von diesem entsprechend überprüft. Heeb hält dem entgegen, dass die IV-Stelle «doch Teil der kantonalen Verwaltung» ist und der Regierungsrat und die Vorgesetzten «über Mitarbeitergespräche und Personalentscheide» Einfluss nehmen könnten.
Insgesamt bewertet der Regierungsrat die neue IV-Praxis deutlich positiver als der Interpellant. Früherfassung, Frühintervention und Integrationsmassnahmen hätten positive Wirkungen. Insbesondere Personen mit psychischen Problemen hätten vorher zu rasch eine Rente erhalten. Ein «eigentliches Erfolgsmodell» sei die Zusammenarbeit der Arbeitslosen- und der Invalidenversicherung. Der Regierungsrat weist auch auf ein statistisches Problem hin. Die IV- Stellen müssen seit der 5. IV-Revision auch bei einer erfolgreichen Eingliederung zu eine Rentengesuch Stellung nehmen, welches in solchen Fällen oft ab- gelehnt werde. Der Regierungsrat bestätigt, dass die Ausgaben für Ergänzungsleistungen zugenommen haben. Bei den individuellen Prä- mienverbilligungen kann er jedoch keine Auswirkungen der IV- Revision erkennen. Für einen verstärkten finanziellen Ausgleich zu Gunsten der Gemeinden sieht der Regierungsrat keinen Anlass. Der Kanton werde durch die höheren Ergänzungsleistungen finanziell ebenso belastet wie die Gemeinden.
Source: ThurgauerZeitung

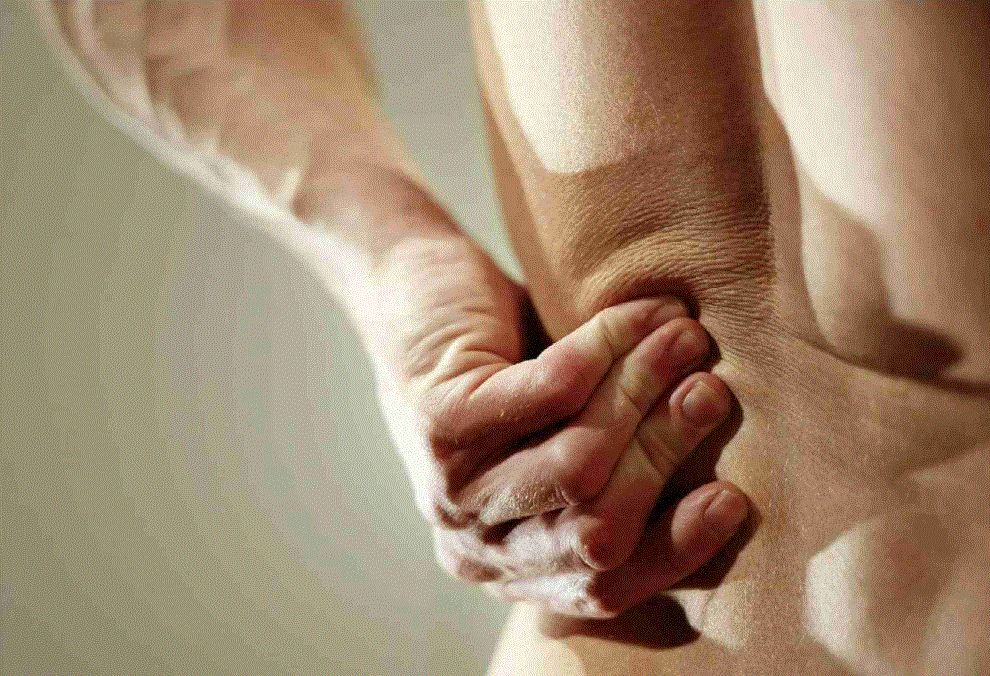 Gemäss der Studienautorin wirkt sich eine Rente bei Schmerzpatienten stabilisierend aus. Foto: Getty Images
Gemäss der Studienautorin wirkt sich eine Rente bei Schmerzpatienten stabilisierend aus. Foto: Getty Images