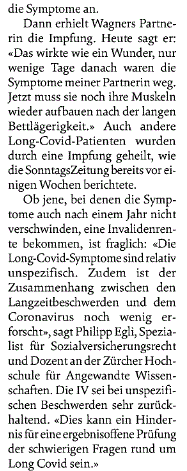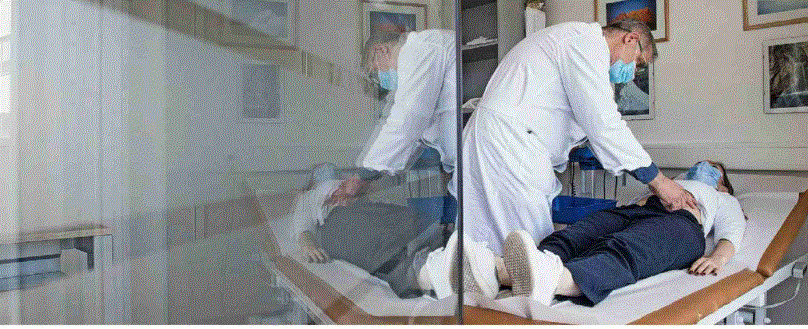(Schaffhauser Nachrichten)
Das Inklusionsprojekt «Schiffli» bietet Kindern mit Beeinträchtigungen und besonderem Betreuungsaufwand Kita-Plätze in Schaffhausen an. Aber die Finanzierung gestaltet sich oft schwierig: Eltern können sich die Plätze häufig nicht leisten – und der Kanton zahlt auch nicht.
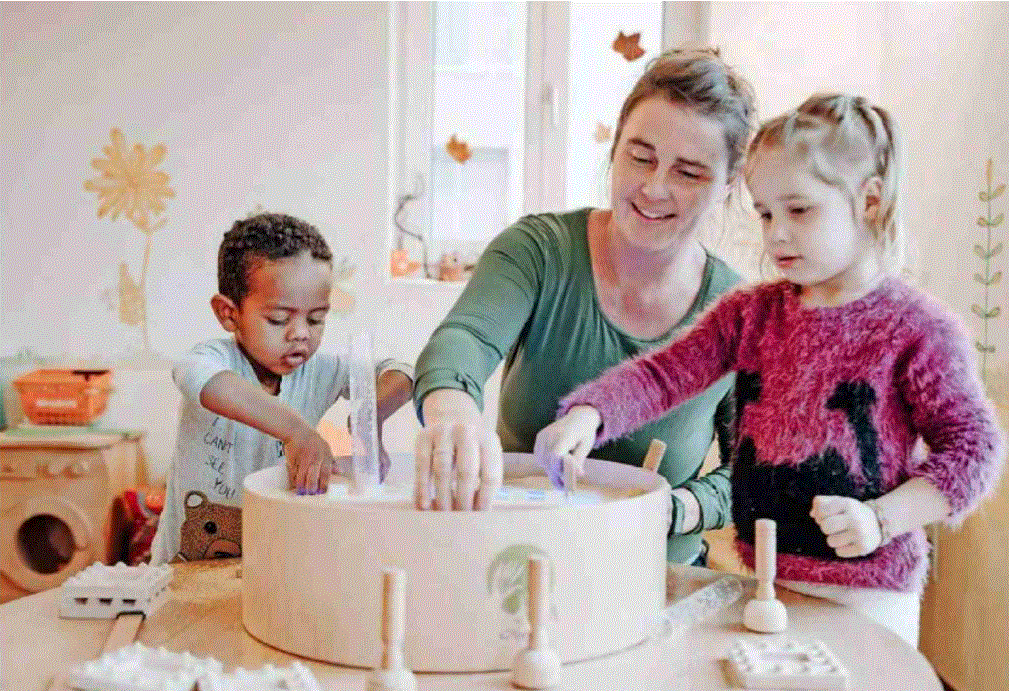
Katja Toth, sozialpädagogische Leiterin des I nklusionsprojekts «Schiffli», spielt mit Naod und Clod im Spielhuus Krebsbach Bild Roberta FELE
Elena Stojkova
Eine Mutter besucht die Kindertagesstätte Spielhuus Krebsbach. Sie ist ohne ihr Kind gekommen. Ihr gefällt die Umgebung, wie die Betreuerinnen mit den Kindern spielen – sie fühlt sich wohl. Gern hätte sie hier einen Platz für ihr Kind. Aber etwas hemmt sie. Erst am Schluss der Besichtigung sagt sie zu Betreuerin Katja Toth, dass es ein Problem gebe. Ihr Kind habe eine Behinderung. «Das ist kein Problem», sagt Toth zu ihr. Dann bricht die Mutter vor Erleichterung in Tränen aus.
Dies sei ein Schlüsselmoment gewesen, an den sich Toth immer wieder erinnert, wie sie sagt. Es ist einer dieser Momente, der ihr zeigt: Es muss sich etwas ändern. Toth ist die sozialpädagogische Leiterin des Pilotprojekts «Schiffli». Die Spielhuus-Tagesstätten Schaffhausen hatten das Projekt vor fast zwei Jahren gestartet (SN vom 14. September 2019). Die Idee: Plätze für Kinder mit besonderen Betreuungsbedürfnissen in die Kitas integrieren, eine Art Sonderschule für die Kleinsten schaffen. Es gibt sie also, die Plätze für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Das Problem liegt anderswo: bei der Finanzierung dieser Plätze.
Drei Standorte hat das Spielhuus, das seit 2002 besteht, in der Stadt Schaffhausen. Von Beginn an wurden einzelne Kinder mit besonderen Betreuungsbedürfnissen aufgenommen. Im Moment besuchen gesamthaft 25 «Schiffli»-Kinder die Spielhäuser, die meisten davon sind im Krebsbach-Spielhuus. Sie haben ganz unter-schiedliche Hintergründe: Einige weisen Störungen in der Entwicklung auf, andere haben Sprachdefizite oder sind Teil eines schwierigen Familiensystems, haben beispielsweise eine Mutter im Teenager-Alter oder Eltern, die flüchten mussten. Wieder andere haben mehr oder weniger ausgeprägte Verhaltensauffälligkeiten oder eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung
«Es ist schade, dass die Eltern, die so schon belastet sind, zusätzlich belastet werden.»
Katja Toth Sozialpädagogische Leiterin Projekt «Schiffli»
Die Räumlichkeiten sind in den letzten Jahren alle barrierefrei gestaltet worden. Das Räumliche ist aber nur das eine. Fachlich bilden sich die Betreuungspersonen immer wieder weiter, schulen sich für jede individuelle Beeinträchtigung, mit der sie zu tun haben. Verschiedene Fachstellen des Kantons unterstützen sie dabei.
Kosten bleiben an den Eltern hängen
Wie Toth sagt, hat das Spielhuus ein- bis zweimal im Monat eine Anfrage bezüglich eines Platzes für ein Kind mit besonderen Betreuungsbedürfnissen. In den letzten zwei Monaten habe es drei Fälle gegeben, für die das Spielhuus Offerten für einen Platz geschrieben hat. Bis es zu dieser Offerte kommt, braucht es viel Arbeit und Vertrauen: Die Eltern teilen die Diagnose ihres Kindes mit der Kita, Besuche sowie Gespräche mit verschiedenen Fachstellen finden statt, Betreuende und Kinder lernen sich kennen. So kann man abschätzen, was das Kind braucht. Manchmal ist dies eine Eins-zu-eins-Betreuung. Was dann folgt, ist nicht selten Enttäuschung, weil die Behörden den Finanzierungsantrag ablehnen. «Dann war die investierte Energie und Zeit umsonst», sagt Toth. Denn in solch einem Fall bleiben die Kosten an den Eltern hängen, und diese können sich die nötige Extrabetreuung, die ihr Kind braucht,ohne Unterstützung des Kantons oft nicht leisten. Um die Beiträge müsse man regelrecht kämpfen, sagt Toth. «Es ist schade, dass die Eltern, die so schon belastet sind, zusätzlich belastet werden.»
«Unerträglich wenig Mittel»
Es kommt auch vor, dass das Spielhuus selbst interessierten Eltern absagen muss, weil Ressourcen fehlen. Abzusagen falle schwer, sagt Toth. Viele Krippen würden gern Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf aufnehmen. Manche tun es aus Good- will. Und merken dann, dass es zu viel ist. «Wenn niemand finanzieren will, müssen diese Kinder wohl oder übel wieder vor die Tür gesetzt werden – auch wenn die Kitas das auf keinen Fall wollen», sagt Toth. Die Situation sei unbefriedigend: für die Kinder, für die Eltern, für die Betreuerinnen und Betreuer. «Die Bereitschaft der Behörden, Gelder zu sprechen, ist noch nicht da. Die Kitas sind oft machtlos.» Fachstellen versuchen zwar oft, auszuhelfen, aber auch ihnen fehlen Ressourcen.
Manchmal gebe es zwar gute Lösungen, sagt Gabriela Wichmann, Präsidentin des Vereins Spielhuus-Tagesstätten. Die Sozialhilfe kann in Einzelfällen Familien, welche sie in Anspruch nehmen, aushelfen. Einen Teil der Kosten subventioniert als einzige Gemeinde im Kanton die Stadt Schaffhausen. Vom Kanton aber gebe es keine Standardlösung. «Für die Eltern sind diese Plätze zu teuer, für den Staat sind diese Plätze zu teuer. Und die Kitas haben gerade für solche Fälle unerträglich wenig Mittel.»
Was heisst das finanziell konkret? Ein Platz für ein Kind ohne besondere Bedürfnisse kostet im Spielhuus 122 Franken pro Tag. Hier rechnet man mit einer Fachkraft pro fünf Kinder. Ein Kind mit besonderen Bedürfnissen braucht teilweise aber viel mehr als 20 Prozent der Aufmerksamkeit seiner Betreuerin. Schnell müssten füreinen Platz dann über 400 Franken verrechnet werden. «Bei Sonderschulen gibt es solche Budgets. Bei der frühen Förderung noch nicht.»
Gestraft seien diejenigen Eltern, die den vollen Preis selbst bezahlen sollten. «Manchmal reicht eine dreimonatige Eins-zu-eins-Betreuung», sagt Wichmann. Sie gibt ein Beispiel: «Es kann sein, dass ein Kind intensive Betreuung während der Scheidung seiner Eltern braucht.» Wenn es diese bekommt, lösen sich Verhaltensauffälligkeiten oft schnell auf, und das Kind kann Anschluss in der Gruppe finden. Wenn es diese nicht bekommt, könne es zwischen Stuhl und Bank fallen. «Alle wollen solche Angebote, aber niemand will dafür zahlen», sagt Wichmann.
Am falsche Ort gespart
Die beiden Frauen wünschen sich, dass die Finanzierung ohne Diskriminierung funktioniert – dass alle Eltern gleicheChancen haben auf einen Betreuungsplatz, ganz egal, welche Art von Betreuung ihre Kinder brauchen und wie viel diese kostet. Mit anderen Worten: dass Inklusion selbstverständlich wird.
«Alle wollen solche Angebote, aber niemand will dafür zahlen.»
Gabriela Wichmann Präsidentin Verein Spielhuus-Tagesstätten
Geschätzt 20 Prozent der Kinder haben eine Art von Förderbedarf. Trotzdem seien Beeinträchtigungen und erhöhter Betreuungsaufwand nach wie vor Tabuthemen, sagt Toth. «Wir müssen noch viele Vorurteile abbauen.» Die Kinder seien dem Thema gegenüber viel offener als Erwachsene, würden Fragen stellen. In den Spielhuus-Kitas haben Kinder ganz unter-schiedlichen Alters miteinander zu tun. «Und sie anerkennen die Einzigartigkeit des jeweils anderen.» Loslassen müsse man die Schemata und Raster, in die man die Kinder einordnen will. «Das Kind muss in kein Raster passen. Wir müssen querdenken, uns an die Kinder anpassen.»
Bei der Betreuung von Kindern zu sparen, sei gravierend, sagt Toth. Integrationschancen würden verpasst. Das ziehe später Sozialkosten nach sich. Ausserdem können Eltern, die ein Kind mit Beeinträchtigung selbst betreuen, selten berufstätig sein. In eine diskriminierungsfreie Kinderbetreuung zu investieren lohne sich also auf allen Ebenen. «Es ist noch ein weiter Weg. Aber er wird sich auszahlen.»
Projekt «Schiffli»
Anfang 2020 hat das Spielhuus Schaffhausen ein Inklusionsprojekt gestartet – das «Schiffli». Finanziell unterstützt wird es von der Windler-Stiftung und Pro Infirmis. Der Pilotbetrieb war somit für zwei Jahre gesichert. Diese sind aber bald vorüber. Wie es mit der Finanzierung ab Januar weitergeht, ist unklar. Das Spielhuus versucht, weiterführende Lösungen anzubieten
Kanton prüft Unterstützung für Eltern und Kitas
Dass im Kanton Schaffhausen ein Bedarf an Kita-Plätzen für Kinder mit Beeinträchtigungen oder besonderem Betreuungsaufwand bestehe, sei dem Erziehungsdepartement bewusst, schreibt Erziehungsdirektor Patrick Strasser auf Anfrage der SN. Genaue Zahlen kenne man zwar nicht – man gehe aufgrund Rückmeldungen von der Heilpädagogischen Früherziehung sowie der Volksschule nach Eintritt in den Kindergarten aber von etwa 20 bis 25 Kindern pro Jahr aus, die einen entsprechenden Platz benötigen würden.
Aktuell bestehe keine spezifische Unterstützung durch den Kanton bei der Finanzierung der Kita-Plätze für Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf. «Aus meiner Sicht ist der Hand-lungsbedarf ausgewiesen», schreibt Strasser weiter. Vor einiger Zeit sei eine Arbeitsgruppe daher beauftragt worden, sich diesem Thema anzunehmen und Lösungsvarianten zu prüfen. «Dabei ist die Definition eines
Kurzfristige Hilfe nicht möglich
Die Entscheidung, ob und wie der Kanton die Eltern oder die Kitas, die Kinder mit besonderen Bedürfnissen betreuen, unterstützt, liege aufgrund der wiederkehrenden Kosten beim Kantonsrat oder eventuell, im Falle eines Referendums, gar beim Volk. Auf das Projekt «Schiffli»(siehe Artikel oben) angesprochen, meint Strasser: «Es macht sicherlich Sinn, bestehende Angebote in eine Lösung mit einzubeziehen und das Rad nicht neu zu erfinden.»
Eine der Lösungsvarianten, dienoch von der Arbeitsgruppe geprüft würden, sei der Einbezug des Projekts «Schiffli». «Da jede staatliche Ausgabe eine gesetzliche Grundlage braucht, dürfte eine kurzfristige Unterstützung über die ordentlichen Budgetmittel aber leider nicht
möglich sein.» (est)