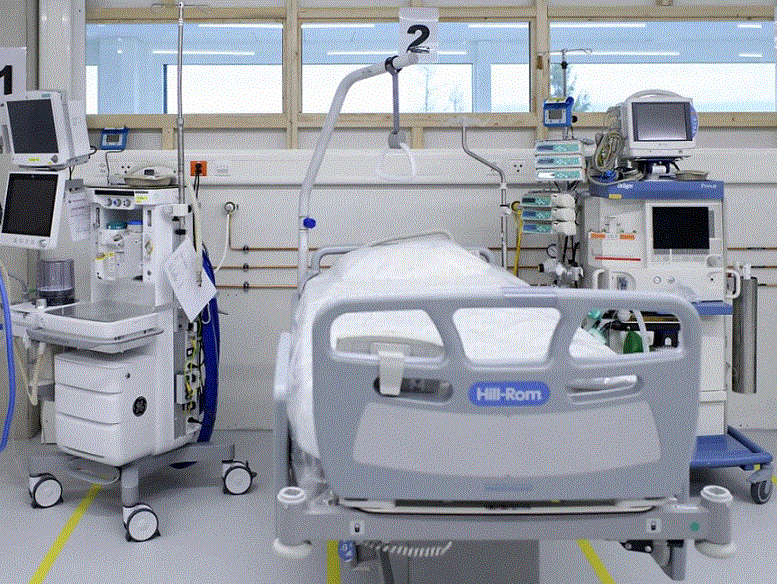(htr Hotel Revue)
Immer mehr Angebote wie rollstuhlgängige Wanderungen oder Führungen in Gebärdensprache inkludieren Menschen mit Handicap.

Er weiss, wovon er spricht: Stephan Gmür berät Gäste, die mit einer Mobilitätseinschränkung das Unterengadin erleben möchten / Dominik Taeuber
Christine Zwygart
Menschen mit einer Beeinträchtigung nehmen die Umwelt anders wahr. Vielleicht, weil sie nichts sehen, schlecht hören oder im Rollstuhl sitzen. Ihre Bedürfnisse sind unterschiedlich, ihre Sehnsüchte aber oft dieselben: am Leben teilnehmen, Ausflüge machen und auch mal unbeschwerte Freitage erleben. Procap Schweiz ist seit Jahren Spezialistin für barrierefreie Ferien und versteht sich auch als Informationsplattform. Wo die grösste Herausforderung heute noch liegt, weiss Helena Bigler, Ressortleiterin Reisen und Sport: «Damit Menschen mit einem Handicap einen unbeschwerten Ausflug machen können, müssen alle Dienstleistungen entlang der Servicekette für sie zugänglich sein.» Das beginnt bei der Anreise und dem Parkplatz, geht weiter über den Zugang zum Gebäude bis hin zu geeigneten Toiletten und Restaurants. «All diese Infos müssen für die Betroffenen bereitgestellt werden, damit sie sich vorgängig von der Barrierefreiheit ein Bild machen können.»
Kunst für Blinde und Wandern im Rollstuhl
Mit dieser Thematik setzt sich auch das Zentrum Paul Klee in Bern seit mehr als zehn Jahren auseinander. Hier gibt es Führungen, die in Gebärdensprache übersetzt werden, und intensive Betrachtungen von Bildern mittels Worten, damit sie auch für Sehbehinderte fassbar sind. «Für uns ist wichtig, dass diese Anlässe allen Gästen offenstehen und wir Menschen mit Beeinträchtigungen so inkludieren», erklärt Dominik Imhof, Leiter Kunstvermittlung. Das Zentrum Paul Klee trägt denn auch das Label «Kultur inklusiv» und verpflichtet sich, sein kulturelles Leben auf sämtlichen Ebenen für alle zu öffnen. Deshalb gibt es hier auch Broschüren in leichter Sprache oder Kurzführer in Grossschrift – und Blindenhunde sind willkommen. Gerade ist ein Beirat in Planung, dem auch Menschen mit einer Beeinträchtigung angehören sollen. «Mit diesen Testpersonen möchten wir künftig herausfinden, ob neue Ausstellungen allen Bedürfnissen gerecht werden», sagt Imhof. Steht freier Platz für Rollstühle zur Verfügung? Sind die Vitrinen nicht nur stehend einsehbar? Und ist das Licht hell genug, damit der Text lesbar ist? Auch die Rigi hat den Anspruch, ein Ausflugsziel für alle zu sein.
«Alle Leistungsträger entlang unserer Dienstleistungskette sind gefordert.»
Jeanine Züst Geschäftsführerin RigiPlus AG
Seit vergangenem Sommer können Menschen im Rollstuhl hier einen geländegängigen Mountaindrive ausleihen und zwei Wanderwege erleben. Zehnmal wurde das geländegängige Gefährt gebucht, die Rückmeldungen seien durchwegs positiv, so Jeanine Züst, Geschäftsführerin der RigiPlus AG. «Mit vereinten Kräften und der Unterstützung allerLeistungsträger auf und am Berg bleibt die Barrierefreiheit ein ständiges Ziel.» Restaurants, Hotelzimmer und Toiletten für Rollstuhlfahrer gibt es bereits, ebenso einen gut zugänglichen E-Bus nach Rigi Kaltbad – und dank Anpassungen der Perrons und neuen Wagen der Rigi-Bahnen,die ab Frühling fahren, wird ein barrierefreies Einsteigen möglich. «Dies alles wäre ohne die Zusammenarbeit mit Partnern wie OK:GO und der finanziellen Unterstützung der Stiftung Cerebral sowie der Schweizer Paraplegiker-Stiftung nicht möglich gewesen», ergänzt die Geschäftsführerin. Zudem hätten sie von Erfahrungen anderer Regionen profitiert, und «ich nehme mir gerne Destinationen wie Scuol als Vorbild».
Betroffene beraten und helfen Betroffenen
Was genau machen denn die Destination Scuol und das Unterengadin anders? Hier arbeitet Stephan Gmür, der seit einem Gleitschirmunfall 2014 im Rollstuhl sitzt. Er hilft Menschen mit eingeschränkter Mobilität bei ihrer Ferienplanung, gibt ihnen Tipps für Ausflüge und Erlebnisse – auf Augenhöhe. «Es gibt Fragen, die ein Fussgänger kaum beantworten kann», sagt er. Aus eigener Erfahrung weiss der Berater, welche Hindernisse die mietbare Antriebshilfe für den Rollstuhl noch meistert. Oder wo es unüberwindbare Hürden gibt.
Nicht alle Betroffenen brauchten die gleichen Rahmenbedingungen, betont Stephan Gmür. Er sei fit und könne grössere Steigungen meisternals andere. Auch die Breite der Rollstühle variiere – was die Norm für Barrierefreiheit jedoch nicht berücksichtigt. Deshalb hat die Destination im vergangenen Jahr im Val Müstair alle seine Museen, Hotels und Restaurants ausgemessen und die Daten in der App Ginto veröffentlicht – von Türbreiten über Untergrund der Böden bis zu Zugängen. So kann jede und jeder selber entscheiden, was machbar ist. Für 2022 ist nun eine flächendeckende Testung im Unterengadin geplant.
«Informationen zu barrierefreien Hotels und Angeboten müssen zugänglich sein.»
Helena Bigler Ressortleiterin Reisen und Sport, Procap Schweiz
Hemmschwellen abbauen und informieren
Um Touristikerinnen und Hoteliers zu sensibilisieren, bietet Procap Schweiz die Schulungen «Tourismus inklusiv» an. Dabei wird aufgezeigt, mit welchen Hinweisen und Materialien es möglich ist, barrierefreie Angebote zu schaffen. «Wir gehen auf die diversen Bedürfnisse ein und lassen Betroffene erzählen», erklärt Helena Bigler. Sie ermuntert alle, ihre Daten und Infos dann öffentlich zugänglich zu machen, via Website oder Onlineplattformen, so wie das zum Beispiel die Region Morges am Genfersee vorbildlich macht. Und: «Mein Wunsch wäre, dass gerade bei Neubauten oder Projekten von Beginn weg an Menschen mit Handicap gedacht wird.»
procap.ch, zpk.org, rigi.ch,engadin.com, ginto.guide
Gästebedürfnis
Eine Chance für die Branche
Welche Kriterien müssen beachtet werden, wenn ein Hotel für alle Gäste – mit oder ohne Beeinträchtigung – ein Daheim auf Zeit sein möchte? Der Hotelcheck für barrierefreie Betriebe von HotellerieSuisse bietet die Möglichkeit, eine Bestandsaufnahme durchzuführen. Beim Audit müssen die Unternehmen kein Anforderungsniveau erreichen, sondern erhalten Rückmeldung über die aktuelle Situation und Verbesserungsvorschläge. Geprüften Hotels stehen dann Piktogramme zur Verfügung, mit denen sie ihre Barrierefreiheit transparent nach aussen tragen und über verschiedene Plattformen sichtbar machen können. Dies gibt den Gästen die Möglichkeit, vorab zu erfahren, welche Bereiche im Betrieb für sie ohne Hindernisse zugänglich sind. Der Hotelcheck ist ein nationales Projekt von der Stiftung Claire & George, HotellerieSuisse und Schweiz Tourismus in Zusammenarbeit mit Fach und Behindertenorganisationen – unterstützt von Innotour, dem Förderinstrument vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco).
Die Zimmer je nach Bedürfnis der Gäste einrichten
Urs Niffeler ist Direktor im Hotel Sonnmatt, das ein Kurhotel, eine Residenz und in Partnerschaft mit der Gruppe Zurzach Care eine Rehabilitationsklinikvereint – und somit ganz unterschiedliche Kundensegmente. Eristüberzeugt, dass Barrierefreiheit in der Beherbergung an Bedeutung gewinnen wird: «Wir haben wenig Individualtouristen, und die Aufenthaltsdauer unserer Gäste beträgt durchschnittlich mehr als zwei Wochen. Schon deshalb ist es essenziell, dass wir ihnen ermöglichen können, sich wie zu Hause zu fühlen.» Die Zimmer mit Blick auf den Vierwaldstättersee und die Luzerner Voralpen haben den Charme eines Hotelzimmers, bieten aber gleichzeitig genügend Platz und Hilfsmittel, wo diese nötig sind. Im Badezimmer können beispielsweise Haltehilfen angebracht werden, wenn der Gast dies wünscht. «So können wir ganz gezielt auf die individuellen Bedürfnisse aller Gäste eingehen und die Zimmer während des Aufenthalts adaptieren», sagt der Hotelier. In Zusammenarbeit mit zwei Schreinern hat der Betrieb zudem ein Bett entwickelt,das alle Funktionalitäten eines Spitalbettes bietet, aber das Aussehen eines Hotelbettes behält. Urs Niffeler rät seinen Branchenkollegen:«Eine Bestandsaufnahmeist zwingend. Der Betrieb muss mithilfe von Fachwissen beleuchtet werden. Optimierungen können dann schrittweise oder auch als Gesamtprojekt vorangetrieben werden.» Mehr über das Audit und die Erfahrungen im «Sonnmatt»in Luzern erfahren Sie unter: hotelleriesuisse.ch/story-barrierefreiheit